 Die Wahl Karls zum römisch-deutschen König fand vorläufig wenig Anhang im Reich. Kaiser Ludwig IV., von den avigonesischen Päpsten der Zeit herabwürdigend „der Bayer“ genannt, war noch am Leben und er genoss in Teilen des Reichs ungebrochene Anerkennung. Jenseits Böhmens hatte sich hauptsächlich entlang des Niederrheins eine Opposition gegen den gealterten Kaiser gebildet. Besonders hier hatte sich Ludwig durch sein partikulares Vorgehen bei der Neuvergabe des erledigten niederländischen Erbes seines verstorbenen Schwagers, Graf Wilhelm IV. von Holland, Neider und Oppositionelle unter den Regionalfürsten geschaffen. Trotz seiner, ganz auf Mehrung der eigenen Hausmacht ausgerichteten Vergabepolitik erledigter Reichslehen, war seine Regierung ansonsten auf Konsens mit den großen Dynastien im Reich ausgelegt. Er vermochte den Frieden weitgehend zu waren, wovon Handel und Gewerbe profitierten. Nutznießer waren in erster Linie die Städte, deren Aufschwung sich weiter fortsetzte. Sie waren es auch, die den Kaiser weiter stützten. Für Karl kam es also darauf an, unter seinem Regiment den Landfrieden ebenfalls nach Kräften zu fördern und zu wahren, um hiermit die Reichsstädte für sich zu gewinnen.
Die Wahl Karls zum römisch-deutschen König fand vorläufig wenig Anhang im Reich. Kaiser Ludwig IV., von den avigonesischen Päpsten der Zeit herabwürdigend „der Bayer“ genannt, war noch am Leben und er genoss in Teilen des Reichs ungebrochene Anerkennung. Jenseits Böhmens hatte sich hauptsächlich entlang des Niederrheins eine Opposition gegen den gealterten Kaiser gebildet. Besonders hier hatte sich Ludwig durch sein partikulares Vorgehen bei der Neuvergabe des erledigten niederländischen Erbes seines verstorbenen Schwagers, Graf Wilhelm IV. von Holland, Neider und Oppositionelle unter den Regionalfürsten geschaffen. Trotz seiner, ganz auf Mehrung der eigenen Hausmacht ausgerichteten Vergabepolitik erledigter Reichslehen, war seine Regierung ansonsten auf Konsens mit den großen Dynastien im Reich ausgelegt. Er vermochte den Frieden weitgehend zu waren, wovon Handel und Gewerbe profitierten. Nutznießer waren in erster Linie die Städte, deren Aufschwung sich weiter fortsetzte. Sie waren es auch, die den Kaiser weiter stützten. Für Karl kam es also darauf an, unter seinem Regiment den Landfrieden ebenfalls nach Kräften zu fördern und zu wahren, um hiermit die Reichsstädte für sich zu gewinnen.
Grundsätzlich hatte die Wahl Karls IV. den Beigeschmack eines von außen, von reichsfremden Kräften gesteuerten Staatsstreichs. Von Papst Clemens VI. losgetreten, dessen Kirchenbann-Politik gegen den bisherigen Kaiser selbst unter Klerikern des Reichs kritisch bewertet wurde, kam es zum Wahlakt hinter mehr oder minder verschlossenen Türen. Die Berufung nur jener gegen den amtierenden Kaiser in Opposition stehenden Wahlfürsten, deren Stimme Karl sich sicher sein konnte, war anrüchig. Um nach erfolgter Wahl Vorgang und Ergebnis jenseits dieses kleinen Kreises antikaiserlicher Kurfürsten publik zu machen, um der Angelegenheit damit einen legalen Anstrich zu verleihen, ließ Karl gemäß üblichem Prozedere eine Anzahl großer Reichsstädte und Fürsten von seiner Wahl zum römisch-deutschen König schriftlich informieren, erhielt eben gerade von den Städten aus den bereits genannten Gründen kaum Resonanz. An Papst Clemens VI. in Avignon schickte Karl eine große Gesandtschaft, angeführt von Erzbischof Ernst von Prag, um seinem Freund, Gönner, Initiator der Wahl und faktischen Königsmacher die erfolgte Wahl offiziell anzuzeigen. In der Zwischenzeit, bis zum Erhalt einer Rücknachricht vom Heiligen Stuhl, schritt Karl als neuer König zur ersten Machtdemonstration. Er eilte mit einem Miilitäraufgebot dem Bischof von Lüttich zu Hilfe, der im Streit mit der Stadt Lüttich stand, doch war es schon zu spät. Die vom Bischof belagerten Städter hatten in einem wütenden Ausfall dessen Heer geschlagen und zerstreut. Karl musste unverrichteter Dinge wieder umkehren. Die von ihm so gedachte Demonstration königlicher Autorität verfehlte ihren Zweck völlig. Nach einem Zwischenstopp in Trier, bei Erzbischof Balduin, dem Großonkel, ging es weiter zum Vater, der sich fern Böhmens in den luxemburgischen Stammlanden aufhielt. Dort bereitete dieser sich, trotz zwischenzeitlich fast völliger Blindheit auf einen Feldzug an der Seite seines königlichen Freundes Philipp VI. von Frankreich vor. Es galt das unter der persönlichen Führung Eduards III. zwischen französisch Flandern und Paris plündernde englische Heer zu stellen und zu schlagen, wenigstens abzudrängen um so die Gefahr von der französischen Metropole abzuwenden.
Das Fanal bei Crécy
In der zweiten Augustwoche zogen Karl und Vater Johann an der Spitze eines Kontingents von rund 500 Panzerreitern zunächst nach Paris. Unter diesen waren zahlreiche böhmische Barone sowie Ritter aus der Grafschaft Luxemburg. Karl folgte nur widerwillig und gezwungenermaßen, wollte sich aber umgekehrt, so kurz nach seiner Wahl, einen betont kriegerischen Habitus aufbauen, um dem Kaiser, den Fürsten sowie den Städten des Reichs seine Entschlossenheit zu demonstrieren.
Sie vermuteten den französischen König noch in Paris anzutreffen, der zu dieser Zeit allerdings bereits bei seinen Truppen im Felde stand. Bei ihrer Ankunft war die Stadt in hellem Aufruhr, ein englischer Angriff wurde erwartet und die Abwehr mit provisorischen Mitteln hastig vorbereitet. Erste Gebäude der Vorstädte riss man schon nieder, was unter den Parisern großen Unmut hervorrief. Die Lage beruhigte sich, als Kundschafter die Nachricht vom Rückzug Eduards brachten und dass ihm das zahlenmäßig vielfach überlegene französische Heer dicht auf den Fersen war. Johann Sorge war jetzt die bevorstehende Schlacht zu versäumen und brach in aller Eile auf, um möglichst schnell zum Heer Philipps aufzuschließen. Er fand die französische Streitmacht unweit Paris. Eine Schlacht lag in der Luft und nach der Lage der Dinge musste sie blutig werden. Am 26. August 1346 stellten sich die schwer bedrängten englischen Truppen bei Crécy in der Picardie zur Abwehr auf. Ihre Lage war wirkte aussichtslos. Zahlenmäßig deutlich unterlegen, vor allem hinsichtlich schwerer Reiterei, war der Ausgang der Schlacht zugunsten der Franzosen nicht anzuzweifeln. Eduard III. verstand aus der Not eine Tugend zu machen und die eigenen Reihen äußerst effektiv aufzustellen, wobei er das Gelände zu seinem Vorteil nutzte. Die Franzosen, mit ihnen die Verbündeten sowie besoldete Hilfsvölker, zumeist Genuesen, waren aufgrund der drückenden Überlegenheit in zuversichtlicher, regelrecht euphorischer Stimmung und zeigten schon bei der Schlachtaufstellung Nachlässigkeiten. Ein Regenschauer kurz vor der Schlacht weichte den Untergrund auf, was die Reiterei im weiteren Verlauf erheblich behinderte. Noch schlimmer fiel ins Gewicht, dass die Armbrustsehnen der genuesischen Söldner aufgeweicht wurden, so dass deren Feuerreichweite erheblich gemindert wurde. Philipps Heerführer, Karl II. von Valois, setzte ohnehin ganz auf die schlagkräftige und zahlreiche Reiterei. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die berittene französische Ritterschaft, in stolzem Übermut, unter allen Umständen diesen vermeintlich leichten Sieg alleine erkämpfen wollte, weswegen Johanns böhmisch-deutsche Truppen erst im dritten und letzten Treffen gruppiert waren. Die Franzosen sahen anhand der gegnerischen Aufstellung, dass sie es nur mit Fußtruppen und abgesessener Reiterei zu tun bekamen und waren überzeugt, schon im ersten Angriffsschwung die gegnerischen Linien durchbrechen und un zersprengen zu können. Eine verhängnisvolle Fehlannahme, wie sich herausstellte. Die Ortsgegebenheiten ließen einen massierten Angriff auf breiter Linie nicht zu. Auf verhältnismäßig schmalem Streifen und tiefgestaffelt musste man vorstoßen, was für die englischen Langbogenschützen ein leichtes Ziel darstellte. Die zahlenmäßige französische Überlegenheit kam nicht zum Tragen. Der aufgeweichte Untergrund verlangsamte darüberhinaus die Attacke, wodurch die Angreifer nicht nur länger im Feuerbereich der Schützen blieben, auch ermüdeten viele der Pferde rasch, was die Geschwindigkeit weiter herabsetzte und dem Angriff jene Wucht nahm, der sonst jeden Feind einfach niedergeritten hätte.

Die englischen Langbogenschützen richteten ein beispielloses Gemetzel unter den schneidig herangaloppierenden Reitern an. Da wir in Buch 2 den Verlauf der Schlacht schon ausführlich schilderten, reduzieren wir uns nur noch auf das Ergebnis. Der französische König erlitt eine furchtbare Niederlage, fast wäre er in einem verzweifelt geführten letzten Angriffssversuch selbst gefallen. Mehr als zehntausend Tote Franzosen, darunter elf Herzöge, vier Bischöfe, 28 Grafen, über 80 Barone und rund 1.200 Ritter, bedeckten das Schlachtfeld. Nahezu jede französische Adelsfamilie verlor mindestens einen Angehörigen, darunter viele regierende Fürsten oder zukünftige Erben. Das gesamte feudale Herrschaftsgefüge Frankreichs geriet ins Wanken.
Karl entkam dem Blutbad nur durch den Einsatz seiner Leibwache, die ihn regelrecht vom Schlachtfeld retten musste. Die Chronisten sind sich hinsichtlich seines Schlachtbeitrags uneins. Es ist wahrscheinlich und im Grunde nicht anders denkbar, dass er am Angriff des böhmischen Reiterkontingents beteiligt war, im Gegensatz zum Vater aber sicher nicht in vorderster Reihe und im dichtesten Gedränge, das er nicht hätte überleben können. Ob er überhaupt in Kampfhandlungen verwickelt wurde, vermögen wir aus den teils völlig gegensinnigen Angaben nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich trug er Verwundungen davon, da ihm nach Berichten das Pferd zusammengeschossen wurde. Zweifelsfrei und letztendlich glaubwürdig können wir es nicht beantworten. Fest stand, etwas mehr als einen Monat nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König, wäre er beinahe ums Leben gekommen. Der offene Thronstreit mit Kaiser Ludwig IV. wäre hierdurch vorzeitig entschieden worden, noch vor es zum Ausbruch gekommen wäre.
Johann, der blinde König Böhmens, starb wie er es zu leben vorzog, mit dem Schwert in der Hand. In Böhmen war er nie beliebt, belegte er doch das Land zu oft mit schweren Abgaben und Anleihen, womit er seine vielen Feldzüge finanzierte. Umgekehrt blieb das Königreich während all seiner Regierungsjahre unbehelligt von äußeren Feinden. Niemand wagte einen Einfall ins böhmische Kernland, selbst nicht während der großen antiböhmischen Kaiserallianz des Vorjahrs. Prag erlebte unter seiner Regierung einen ersten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung und wuchs stark. Er konnte beim Kaiser weitreichende Handelsprivilegien für die Prager Kaufleute erwirken. Das Gesicht der Stadt begann sich merklich zu wandeln. Die ersten gepflasterten Straßen wurden errichtet und die Zahl der gemauerten Häuser begann zu wachsen. Seine überaus erfolgreiche Heiratspolitik wurde zur Blaupause für den Sohn, der darin zu unerreichter Meisterschaft avancierte.
Krönung am falschen Ort
Nach der Niederlage und dem schockierenden Tod des Vaters, war die Lage für Karl gefährlich. Die nach Frankreich geführten böhmischen Truppen waren größtenteils getötet, gefangengenommen oder zerstreut, bis auf eine Handvoll Überlebende waren ihm kein unmittelbarer Schutz fernab von Böhmen geblieben. Vorerst setzte er sich nach Verdun ab, wo er einige Zeit verweilte, vielleicht um dort möglicherweise doch erlittene Wunden auszuheilen. Ende September reiste er weiter in die Grafschaft Luxemburg und zog sich auf die Burg Arlon zurück. Er rechnete mit einem Schlag des Kaisers, von dem er fest annahm, dass er seine momentane Schwäche ausnutzen würde. Kaiser Ludwig, der sich zu dieser Zeit in Frankfurt am Main aufhielt, also nicht weit ab, unterließ überraschenderweise jede Aktion gegen den gewählten aber bislang ungekrönten Gegenkönig. Es fällt schwer hierfür eine eindeutige Erklärung zu finden. Anscheinend konnte er die Gesamtsituation und die Anhängerschaft Karls nicht richtig einschätzen und wartete lieber weiter ab. Ludwig war, und nicht nur darin zeigten sich gewissen Ähnlichkeiten zu Karl, kein besonders kriegerischer Zeitgenosse. Er gab der Diplomatie, man könnte stellenweise auch sagen, der Intrige, den Vorzug vor dem Schwert. Mancher Chronist unterstellte ihm Feigheit, ein vielgehörter Vorwurf, der ihm schon direkt nach der Schlacht von Mühlberg gemacht wurde. Wir wollen uns kein Urteil erlauben, vielleicht nur soviel, es konnte nicht jeder ein Johann von Böhmen sein, mancher Herrscher war weniger todesmutig, dafür mehr Realpolitiker, um eine heutige Formulierung verwenden zu dürfen. Im Nachinein betrachtet war das ausbleibende Handeln eine grobe Nachlässigkeit des Ludwigs. Zu keinem Zeitpunkt war die Chance größer Karl zu besiegen, als in den Wochen nach der völligen Niederlage von Crécy, als dieser isoliert und weit entfernt von seinen böhmischen Hilfsquellen, inmitten kaiserlich gesinnter Gebiete weilte.
Auch der Oktober verging ohne dass Ludwig sich ernsthaft regte. Karl, nun davon überzeugt der Kaiser würde auch weiterhin passiv bleiben, wagte den nächsten Schritt. Der Großonkel, Erzbischof Balduin von Trier, organisierte die Krönungszeremonie und lud hierzu die wohlgesonnenen Fürsten des Reichs, zu denen zu Beginn, wegen Karls einvernehmlichen Verhältnis zur römischen Kirche, besonders viele geistliche Fürsten gehörten. Die traditionelle Krönungsstätte in Aachen konnte für die Krönungsfeierlichkeiten nicht gewonnen werden, die Stadt hielt es mit dem Kaiser und verweigerte Karl jegliche Anerkennung. Es musste auf Bonn ausgewichen werden, wo sich am 4. November 1346 die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier versammelten. Mit ihnen waren unter anderem die Bischöfe von Münster, Metz, Lüttich und Verdun anwesend.
Die Krönung wurde nach überliefertem Ritus vom Kölner Erzbischof vorgenommen, in dessen Kirchengebiet sowohl der traditionelle, wie auch der provisorische Krönungsort lag. Da sich die Reichskleinodien in den Händen des Kaisers befanden, musste auch hier auf ein Behelf zurückgegriffen werden. Den Gekrönten und dessen Anhänger störten die Defizite vordergründig scheinbar nicht, tatsächlich aber war ihnen natürlich klar, dass wesentliche, althergebrachte Formalitäten alles andere als erfüllt waren und dass Karls Legitimität schon deswegen höchst anfechtbar blieb. Das mittelalterliche Reich bezog seinen selbstverständlichen Herrschaftsanspruch über die restlichen Königreiche der Christenheit aus der sakralen Berücksichtigung zeremonieller Konventionen, hinter denen ein als heilig betrachteter Ritus steckte. Nicht nur die Insignien wie Krone, Zepter, Schwert etc. waren eine Grundbedingung, auch die Beachtung bestimmter Orte und Abläufe verlieh dem künftigen Monarchen des Heiligen Römischen Reichs seine gottgewollte, mit Königsheil gesegnete Autorität. Wie schon Karls Wahl, so konnte auch seine Krönung, wo noch größeres Augenmerk auf Symbolik gelegt wurde, die Zeitgenossen überzeugen. Dass neben den erwähnten Bischöfen, nur sehr wenig und keine der bedeutenden Reichsfürsten und Vertreter der freien Städte zugegen waren, muss als ein deutliches Zeichen mangelnder Akzeptanz im Reich gedeutet werden.
Direkt im Anschluss an den fast unwürdigen Krönungsakt, bestätigte Karl IV. den anwesenden Erzbischöfen und sonstigen Fürsten ihre Rechte und Freiheiten und belehnte sie nach altem Recht mit ihren Ländereien. Umgekehrt leisteten sie ihm die überlieferte Huldigungsformel.
Sitzkrieg zwischen Kaiser und Gegenkönig
Es war an der Zeit nach Böhmen zurückzukehren. Wie würde man ihn dort empfangen, nachdem der alte König, sein Vater, verstorben war? Berechtigten Grund zur Sorge musste Karl nicht haben, seine Popularität in Böhmen war immer schon sehr hoch, und doch blieb eine gewisse Restunsicherheit. Die größte Herausforderung bestand zunächst darin überhaupt unbeschadet nach Böhmen zu gelangen. Ludwig IV. lauerte im Raume um Frankfurt und versperrte ihm den direkten Weg. Fortlaufend beschattet, war Karl gezwungen einen Umweg über das Elsass und Schwaben zu nehmen, wo es ihm gelang die Verfolger abzuschütteln. Von hier begab er sich nach Nürnberg, um von dort auf direktem Weg über Eger nach Prag zu gelangen, das er Anfang des Jahres 1347 glücklich erreichte. Das Volk empfing seinen König, seinen böhmischen König, mit aufrichtiger Freude und in zuversichtlicher Erwartung. Die ihm entgegengebrachte Zuneigung veranlasste Karl zu großherzigen Zugeständnissen gegenüber Adel, Klerus und Bürgerschaft.
Karl gewann schnell einen zufriedenstellenden Eindruck, in Böhmen standen die Dinge beim Besten. Die vielfältigen Maßnahmen während seiner wiederholten Statthalterschaft brachte nicht nur im Land Früchte hervor, es bescherte dem neuen König von Böhmen jenen hohen Vertrauensvorschuss, auf den er seine weitere Haus- wie Reichspolitik aufbauen konnte. Die Krone Böhmens war sicher, die Krone des Reichs galt es aber erst noch durchzusetzen. Im Bewusstsein das böhmische Königreich für den Augenblick in gut bestelltem Zustand zu wissen, verließ er schon nach etwas mehr als einer Woche das Land wieder.
Karl hatte die erlittene Schmach des Bruders in Zusammenhang mit Tirol nicht vergessen. Nicht ohne Eigennutz wollte er dem Bruder und damit dem Hause Luxemburg die strategisch wichtig gelegene Grafschaft zurückholen. Im Grunde konnte er Tirol aber nur durch einen Militärschlag brutal annektieren, denn rechtlich hatte nur Erbgräfin Margarete ein Recht auf Tirol, nicht ihr ehemaliger Ehemann, Johann Heinrich. Die resolute Fürstin warf den verhassten Ehemann bekannterweise buchstäblich aus dem Land und verband sich durch die umstrittene Heirat mit des Kaisers ältestem Sohn, dem Markgrafen von Brandenburg, mit den Wittelsbachern. Wie Karl nach einer erfolgreichen Eroberung den Besitzstand Tirols an den Bruder übertragen wollte ist ungeklärt, doch soweit war man ohnehin längst nicht. Mit einem in Böhmen aufgestellten Heer konnte er nicht nach Tirol ziehen, keines der Anrainerterritorien hätte einen Durchmarsch zugelassen, am wenigsten natürlich die Wittelsbacher und auch nicht die Habsburger. Doch kam aus einer anderen Richtung eine Möglichkeit. Sein Gönner, Papst Clemens VI., hatte mit Mailand ein Bündnis geschlossen. Bislang war die lombardische Metropole tief mit den Luxemburgern verfeindet. Der Papst hatte mit Mailand ein Bündnis gegen den ihm gefährlich gewordenen römischen Emporkömmling Cola die Rienzo (1313 – 1353) geschmiedet. Für Karl hatte diese Verbindung den nützlichen Nebeneffekt, dass er wegen seinem innigen Verhältnis zum Papst vom mächtigen Mailand vorerst nichts zu befürchten hatte. Er konnte nicht nur von der Lombardei aus operieren, sondern dort auch Streitkräfte anwerben um so gegen Tirol vorgehen von Süden kommend vorzugehen. Die Gelegenheit war ausgesprochen günstig, weswegen es Karl auch drängte, denn der Gemahl Margaretes, Ludwig der Brandenburger, befand sich mit seinen Truppen in Litauen und kämpfte an der Seite des Deutschen Ordens. Karl glaubte dadurch leichteres Spiel zu haben, ging aber trotzdem vorsichtig taktierend vor. Sein erstes Ziel führte ihn nach Wien, um dort Herzog Albrecht zu treffen, dann weiter nach Ungarn, wo er sich mit seinem Schwiegersohn, dem König von Ungarn absprach. Er hoffte mit beiden ein Bündnis schließen zu können, ja selbst nur ein Nichtangriffspakt hätte ihm völlig gereicht, doch gaben ihm beide eine Absage. Er reiste ergebnislos wieder nach Böhmen um seinen Zug nach Italien zu planen. Kaiser Ludwig seinerseits war erfolgreicher, er verabredete in Passau eine Dreierallianz mit Österreich und Ungarn wider den böhmischen König und Usurpator der römisch-deutschen Krone. Eine gefährliche Entwicklung die Karl zwang seine Tiroler Pläne für den Augenblick zurückstecken. Die Risiken und Unwägbarkeiten waren zu groß und die Gefahr einer gemeinsamem Intervention der drei verbündeten Mächte war zu ernst.
Im Rücken den erwähnten Bund, schrieb der Kaiser einen Brief an Karl um ihn zum Verzicht auf die Krone des Reichs zu bewegen. Das Schreiben lautete wie folgt: „Wir wundern uns sehr, ja Wir müssen über dein unbesonnenes Unternehmen laut in Gelächter ausbrechen, dass du nämlich die Würde, welche Wir bekleiden, wie ein Mensch ohne Füße und Augen, anzukleiden dich unterstandest. Achtest du etwa die kriegerischen Fürsten, und die unzählbare Menge des auserlesensten Kriegsvolkes, womit unser Hof umgeben ist, für nichts? Wir ermahnen dich auf das Ernsthafteste, den begangenen Fehltritt zu verbessern, und Unsere kaiserliche Milde, Gnade und Vergebung, so lange es noch Zeit ist, anzuflehen, welche Wir, aus angeborener Güte, dir zu ertheilen geneigt sind. Wenn du aber in deiner abscheulichen Narrheit verharrest, so werden Wir aus dem Schlaf erwachen, und deine eingebildete Macht, wie ein irdenes Gefäß, zertrümmern, und wie die Sonnenstäubchen in Nichts verwandeln.“
Der Kaiser legte es auf einen bewusst provokanten Ton an, er wollte ihn aus der Reserve locken und hoffte Karl würde darauf anspringen und ihn vielleicht sogar militärisch in seinen bayrischen Kerngebieten angehen, was die beiden Verbündeten auf den Plan gerufen hätte. Hinsichtlich einer offensiven Vorgehensweise waren beide umgekehrt wenig geneigt gegen Karl vorzugehen. Er ließ sich aber nicht in eine Falle locken, sandte seinerseits einen ähnlich gehaltenen Brief als Antwort und wartete ab. Mittlerweile war Mitte Februar und Ludwig IV. hatte außer Drohungen und Provokationen noch keine unmittelbaren Maßnahmen gegen Karl unternommen, womit der Sitzkrieg weiter ging. Die fehlende konkrete Initiative des Kaisers, mal abgesehen vom schmieden großer Allianzen, bleibt schwer zu begreifen. Als plausible Erklärung kommt uns nur eine Begründung in den Sinn. Der Kaiser suchte mit zunehmender Verzweiflung die Aussöhnung mit der Kirche und die Lösung vom Bann. Es war ihm ziemlich bewusst, dass ein militärisch offensives Vorgehen gegen den päpstlichen Günstling sein Verhältnis zum Papst weiter zerrütten würde. Ludwig IV. gab sich augenscheinlich der illusorischen Annahme hin, es könnte für ihn noch eine Versöhnung mit dem Heiligen Stuhl geben.
Karl blieb in dieser, was den Thron betraf, für ihn ungewissen Zeit nicht untätig und nutzte die Zeit um überfällig gewordene Regentschaftstätigkeiten vorzunehmen. Eine für die weitere Entwicklung seiner Residenz von größter Bedeutung nahm er in Prag vor. Die Stadt war unter König Johann kontinuierlich gewachsen und hatte innerhalb seines historischen Stadtkerns die Grenzen des Wachstums erreicht. An diesem Aufschwung hatte Karl bereits einen gehörigen Anteil in den Jahren seiner wiederholten Statthalterschaft, während der Vater außer Landes tätig war. Mit der Gründung der Prager Neustadt legte Karl den formalen Grundstein zur weiteren Entwicklung Prags zu einer echten Metropole. Die Gründungsurkunde ist datiert auf den 1. April 1347 und zu Burg Pürglitz ausgestellt, wo Karl das Osterfest feierte.
Karl wütet in Tirol
Nach Ostern machte er sich nun doch von Böhmen aus auf den Weg nach Tirol. Die Bedrohung die von der unheilvollen Dreierallianz des Kaisers ausging, erwies sich bislang als ein zwar brüllender aber nach Taten zahnloser Löwe. Es war trotzdem angebracht vorsichtig vorzugehen und nicht offen zu reisen. In Begleitung von nur drei engvertrauten Personen gelangte er unerkannt, als Kaufmann verkleidet, nach Trient, während ihn die Gegner weiterhin in Böhmen vermuteten. In Trient regierte Karls alter mährischer Kanzler, Nikolaus von Brünn, der dort seit 1338 als Bischof residierte. Karl fand hier eine sichere Ausgangsbasis für weitere Aktionen, sowohl nach Norden wie nach Süden. Hier empfing er in den letzten Apriltagen Abordnungen des Papstes und des französischen Kronprinzen Johann, mit dem er das schon vorhandene Bündnis des bei Crécy gefallenen Vaters erneuerte.
Im Laufe des Mai schloss Karl die Aufstellung eines immerhin ansehnlichen Heeres ab und wandte sich damit als erste Maßnahme nach Südosten, gegen die Städte Feltre und Belluno, die er schon einmal dem Markgrafen von Skala weggenommen hatte und seinerzeit einem seiner Getreuen übergab, dann aber wieder verloren gingen. Beide Orte fielen rasch, worauf er nach Norden schwenkte, ins Innere Tirols und Meran einnahm sowie Bozen schrecklich verheeren ließ. Überhaupt hinterließen seine Truppen ein Bild der Verwüstung im Süden der Grafschaft. Sein nächster Schlag richtete sich gegen die Burg Tirol, wo Gräfin Margarete residierte. Sie war auf das Eintreffen seiner Truppen vorbereitet und hatte sich mit ausreichend Truppen und Lebensmittel mutig in der Burg verschanzt, statt nach Norden, nach Innsbruck oder gleich zum kaiserlichen Schwiegervater zu flüchten. Margarete von Tirol war von hartem Holz geschnitzt und eine eiserne Regentin des väterlichen Erbes, zumindest dem Teil, was vom gewaltigen Nachlass an sie gegangen war, nämlich die Grafschaft Tirol.
Karl begann mit der Belagerung, musste aber bald abbrechen, denn von Norden, durch das Inntal kommend, rückte der Kaiser mit eilig zusammengerufenen Truppen zum Entsatz heran. Karl trat ihm entgegen, schlug ihn in mehreren Kleingefechten und drängte ihn , ohne dass ein entscheidender Schlag gesetzt wurde, nordwärts wieder aus der Grafschaft. Mittlerweile war Juni und der aus dem Baltikum zurückgekehrte Ludwig von Brandenburg, des Kaisers ältester Sohn und Margaretes Ehemann, übernahm die Führung im Kampf gegen Karl. Es folgten eine Vielzahl von Scharmützeln, in denen mal die eine, mal die andere Seite Sieger blieb doch weiterhin konnte keiner der Kontrahenten eine Entscheidung ausfechten. Das Land litt weithin unter den Kriegshandlungen. Die Gegenden die von den Truppen beider Seiten durchzogen wurden, erlebten schwere Plünderungen und Verwüstungen. Für Karl war die Situation langfristig die schlechtere. Der Bischof von Trient, Nikolaus von Brünn, war seine einzige sichere Basis, sonst war er weitestgehend von Böhmen abgeschnitten, wie auch von der Grafschaft Luxemburg, die als Erbe aus dem Nachlass des Vaters ohnehin an seinen Halbbruder Wenzel gegangen war und über deren Ressourcen er somit nicht verfügen konnte. In der prekärer werdenden Lage wusste er sich jetzt nicht mehr anders zu helfen, als einen Kurier nach Böhmen zu schicken, mit dem dingenden Auftrag ein Verstärkungsheer zu schicken. Seine dortige Administration ließ ihn nicht im Stich, folgte dem Ruf und rückte mit einer in größter Eile zusammengestellten Schar auf direktem Weg, durch Bayern ziehend, ihrem König entgegen. Noch in Niederbayern wurde das zu schwache und schlecht geführte Kontingent gestellt und abgedrängt, so dass sie wieder nach Böhmen zurückzogen, eine Spur der Verwüstung und Brandschatzung hinterlassend. Des Kaisers Verbündete in Wien und Ungarn rührten sich derweil nicht, Karl hatte sie völlig richtig eingeschätzt, weswegen er den Tiroler Feldzug überhaupt erst wagte. Sie beriefen sich darauf, dass der Kampf in und um Tirol eine familiäre Angelegenheit wäre, noch dazu zwischen des Kaisers Sohn und Karl und nicht gegen den Kaiser und das Reich selbst gerichtet.
Markgraf Ludwig von Brandenburg, Graf von Tirol, Herzog von Bayern, war von diesem böhmischen Einfall nach Bayern höchst alarmiert. Er rechnete damit, dass Karl mit seinen schwachen Restkräften, außer dass er weiter plündernd durch Tirol zog, nichts weiter anrichten konnte, weswegen er sich vom Feind löste und nach Bayern zog, um das Land gegen weitere, von ihm vermutete böhmische Einfälle zu decken.
Wenn Karl auch die Passivität Österreichs und Ungarns richtig vorhersah, so bewies er hinsichtlich seines Tiroler Abenteuers erheblich geringere Voraussicht Es wurde zunehmend zur Realität, dass Tirol vielleicht erobert, aufgrund der exponierten Lage aber dauerhaft nicht von ihm gehalten werden konnte, nicht so lange die Wittelsbacher und die Habsburger einträchtig miteinander verkehrten und in Oberitalien kein potenter Verbündeter existierte. Als schließlich noch Bischof Nikolaus von Brünn im gleichen Jahr starb, war der Moment der Wahrheit endgültig gekommen. Karl verpfändete die wenigen noch gehaltenen Orte, darunter die Städte Belluno und Feltre und zog sich, abermals einmal eine Schneise der Verwüstung hinterlassend, für immer aus Tirol zurück.
Bruder Johann-Heinrich sollte mit Mähren, seiner eigenen Markgrafschaft, entschädigt werden. Dies war gemäß der väterlichen Disposition ohnehin so vorgesehen gewesen, von Karl bislang aber nicht umgesetzt worden. In der Anweisung des väterlichen Testaments erkennen wir Karls hauptsächliches Motiv für seinen Tiroler Feldzug. Karl gefiel der Gedanke ganz und gar nicht, die reiche Markgrafschaft Mähren an den Bruder abtreten zu müssen, noch weniger, weil ja schon die Grafschaft Luxemburg, Stammland und namensgebende Region ihres ganzen Hauses, ihm nicht mehr zur Verfügung stand. Dem Bruder Tirol wiederzuverschaffen, wäre ihm aus so vielerlei Gründen angenehmer gewesen, denn es hätte ihm Mähren erhalten und gleichzeitig den Luxemburgern die wichtigen Alpenpässe verschafft, um vielleicht wieder, in näherer oder ferner Zukunft, in Oberitalien das Glück zu versuchen. Zu alledem wäre den Wittelsbacher Rivalen die strategisch wichtig gelegene Grafschaft entrissen worden. Allein, es war nicht zu bewerkstelligen.
Bis Bruder Johann-Heinrich schließlich, dem testamentarischen Wunsch des Vaters entsprechend, Mähren erhielt, sollten noch mehr als zwei Jahre vergehen. Die Markgrafschaft wurde in dieser Zeit noch um einige Gebiete beschnitten, die direkt unter die Krone Böhmens kamen und damit unter Karls Kontrolle.
Die Tiroler Episode, der Umgang mit dem leiblichen Bruder im Hinblick auf dessen mährisches Erbe, die Verzögerung der Übergabe, die zusätzliche Beschneidung dieser Markgrafschaft und damit Minderung des brüderlichen Erbes, die Missgunst hinsichtlich des Halbbruders, der die luxemburgischen Stammlande als Erbe erhalten und im Gegensatz zu Johann-Heinrich auch zügig in Besitz genommen hatte, bevor Karl auch hier hätte tätig werden können, die ausgeprägte Neigung Dinge im Verborgenen zu tun, gleich ob Königswahl, ob Reisen durch oder entlang verfeindeter Gebiete, die große Vorsicht, fast Übervorsicht in dieser Angelegenheit aber auch das ausgeprägte Geschick in administrativen Dingen, nebst vielen anderen Aspekten, zeichnen das Bild eines vielschichtigen, mit allerlei Talenten bedachten Zeitgenossen, der auf politischer Ebene zur Erweiterung der eigenen Machtbasis sorgsam, zugleich skrupellos abwägt und entscheidet.
Krönung zum König von Böhmen
Ende August 1347 war Karl wieder in zurück in Böhmen und hielt sich in Prag auf. Er musste zuvor den langen Umweg über Aquilla nehmen, wo er sich einschiffte um nach Dalmatien überzusetzen um von dort aus den Landweg durch Ungarn in sein Königreich zu nehmen. Er hatte viel zu große Sorge irgendwie dem Kaiser bzw. dessen energischem Sohn in die Hände zu fallen, weswegen er nicht den kürzesten Weg durch Bayern wagte, auch nicht durch Österreich.
Offiziell war er seit dem Tod des Vaters auf dem Schlachtfeld von Crécy König Böhmens und den damit verbunden Landschaften der Lausitz, Mährens und Schlesiens. Anlässlich eines noch vom damaligen König Johann einberufenen Landtags wurde die spätere Nachfolge geregelt und Karl von den versammelten Ständen zum designierten Nachfolger gewählt, so dass es nach Johanns Tod zu keiner Thronvakanz kam. Was jetzt noch blieb, war das offizielle Zeremoniell als symbolischen Ritus der Thronbesteigung zu zelebrieren. Bei der Krönungsfeier zum römisch-deutschen König fiel die Prachtentfaltung äußerst bescheiden aus. Die Situation um den allgemeinen Thronstreit mit dem Kaiser, die fehlenden Reichsinsignien, der falsche Ort in Bonn, der nicht dem traditionellen Krönungsort entsprach, ließ nur wenige Teilnehmer überhaupt erscheinen und allgemein keine aufwendige Feierlichkeit zu. In seinem eigenen Königreich wollte er die Besteigung des böhmischen Throns mit allen zu Gebote stehenden Mitteln gebührend begehen. Er ließ eine überaus prachtvolle Krone anfertigen, zusammen mit einem Zepter und einem Reichsapfel. Aufbewahrt sollten sie im Veitsdom werden, in einem eigens dazu besonders prunkvoll hergerichteten, dem böhmischen Nationalheiligen Wenzel geweihten Raum. Wenn auch die Arbeiten am Dom natürlich noch nicht abgeschlossen sein konnten, die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten wurden schließlich erst vor rund drei Jahren begonnen, war dieser Raum, ganz nach den Anweisungen Karls, zwischenzeitlich fertiggestellt worden.
Die Krönung wurde auf den 2. September 1347 festgestzt. Er ließ das Datum auch außerhalb Böhmens bekanntmachen, in der Hoffnung hieraus auch Kapital bezüglich der Akzeptanz seiner Wahl zum römisch-deutschen König zu schlagen. Tatsächlich fanden sich aber von den Großen des Reichs nur der Kurfürst von Sachsen, Herzog Rudolf und Sohn ein. Daneben die Bischöfe von Meißen und Lübeck, sowie einige reichsunmittelbare Grafen. Aus Frankreich war kein Vertreter der königlichen Familie gekommen und auch nicht vom ungarischen Hof, mit dem man, trotz der Verschwägerung, aufgrund der kaiserlichen Dreierallianz, in latentem Kriegszustand war. Nur die direkten Vasallen Karls kamen in großer Zahl. Der böhmische und mährische Hochadel und Klerus war komplett anwesend, ferner die von Böhmen abhängigen schlesischen Herzöge. Die Zeremonie war minutiös geplant und entsprach ganz den Neigungen Karls, der schon als Kind am französischen Hof, die dortige Prachentfaltung als Ideal eines königlichen Selbstverständnisses sah. Seine damalige Prägung hatte den allergrößten Einfluss auf spätere Bauprojekte, wie auch auf seinen allgemeinen Habitus als Monarch.
Wir wollen in groben Zügen die Geschehnisse des Vortags, und am Krönungstag dokumentieren.
Samstag 1. September 1346:
Eine Abordnung des böhmischen, mährischen und schlesischen Adels sowie der Kirchenfürsten des Landes, trat in einem symbolischen Akt vor den König und baten, gemäß Inhalt einer von Clemens VI. ausgestellten Bulle, sich zu ihrem König krönen zu lassen. Salbung und Krönung nicht wie die Vorgänger durch den Mainzer Erzbischof, sondern durch den Metropoliten von Prag vornehmen zu lassen. Zugegen waren auch Vertreter der sogenannten Vladiken, des böhmische Freibauernstands, den es im Gegensatz zum deutschsprachigen Reichsteil, noch in großer Anzahl gab. Sie waren berechtigt Waffen zu tragen, ein Privileg das im gesamten Reich Ausdruck des Freistandes war. Im Kriegsfall waren sie zur Heerfolge und Landesverteidigung verpflichtet, gleich dem freien Ritterstand und Hochadel. Über die gestellte Szenerie mag man sich heute wundern, sie als theatralisches Theater abtun, doch war es für das mittelalterliche Selbstverständnis eines auf Wahl beruhenden Königtums von großer Bedeutung. Symbolhandlungen wie diese waren ein fester Teil des Rituals und eine nach außen sichtbare Darstellung von Macht und Würde eines Monarchen.
Karl erließ einen Majestätsbrief, der die päpstlichen Anordnung nochmal von weltlicher Seite her verordnete. Darin wurde festgehalten, dass fortan nur der Erzbischof von Prag die Krönung vornahm und in welcher Weise dies zu geschehen habe. Als Ausdruck der Wichtigkeit, wurde die Urkunde mit einem goldenen Siegel, einer goldenen Bulle versehen, wie sie nur inhaltsschwere Schreiben erhielten.
Im Anschluss begab sich Karl auf die Prager Hochburg, den Wissehrad oder Wyschehrad (tsch. Vyšehrad), zur Andacht in die dortige Hofkirche. Hierauf wurde er wieder zurück in die Schlosskirche, das heißt in den Veitsdom gebracht, wo er der Vesper beiwohnte und abschließend in großem Zug vom Adel und Klerus zu den königlichen Zimmern geleitet wurde.
Sonntag 2. September 1347:
Am Morgen der Krönung begab sich Erzbischof Ernst von Prag, in Begleitung seiner beiden Suffraganbischöfe und weiterer Vertreter des Klerus, in das königliche Gemach. Der König lag in vollem Ornat auf dem Prachtbett. Um ihn postiert standen die höchsten böhmischen Beamten, der Landeskämmerer Jost von Rosenberg, der Landesrichter Andreas von Duba, der Landesmarschall Heinrich von Lippa, der Lehnsrichter Hinko von Waldstein und der Burggraf zu Prag Heinrich–Berka von Duba.
Erzbischof Ernst trat an das Bett heran, hüllte den König in Weihrauch und besprengte ihn mit Weihwasser, bevor er ihn an den Armen emporhob und von je einem Bischof rechts und links zur Schlosskirche geleiten ließ. Voraus gingen die genannten Landesobristen, Krone, Zepter, Reichsapfel und Schwert tragend. Ihnen allen voran schritt der Landeskämmerer mit einem Stab in der Hand, um den Weg anzuzeigen. Es folgte eine Prozession des Hochadels, der sich dem Zug zur Kirche, unter dem Geläut aller Glocken Prags, anschloss. Im Dom wurden die königlichen Insignien auf dem Hochalter niedergelegt und Karl nahm auf einem vorbereiteten Thron platz, die höchsten Würdenträger aus Klerus und Adel rechts und links von ihm. Nach Gebeten und zwei kurzen Predigten, die erste an den Klerus, die zweite an den Adel gerichtet, trat der Erzbischof vor Karl und verlas die vorbereitete Eidesformel in Form einer zeremoniellen Befragung. Zum Abschluss drehte er sich zum versammelten Adel, Klerus und Volk und fragte, „Wollt ihr dem Fürsten Karl für euer Oberhaupt und euren König anerkennen und ihm Gehorsam leisten?“, worauf ein dreifaches, „Radi, radi, radi“, erscholl, „Gerne, gerne, gerne“. Es folgten Gebete der anwesenden Bischöfe und Gesang, woran sich in der Lithurgie das Hochamt anschloss, mit dem Verlesen der Epistel, Auszüge aus den Apostelbriefen. Zwei Äbte bereiteten derweil das Salböl vor und reichten es nach Abschluss der Lesung dem Erzbischof. Unter Salbung des königlichen Hauptes, der Arme und Schultern sprach er die vorgegebene Formel, „Ich salbe dich zum König mit dem heiligen Öle, im Namen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“. Er segnete das königliche Gewand und zog es dem König an, salbte danach dessen Hände und legte ihm den Königsmantel um. Stets jeden Teil unterbrochen durch ein kurzes Gebet, gürtete er ihn mit dem Reichsschwert, steckte ihm einen Ring an den Finger und legte ihm das Zepter und den Reichsapfel in die gesalbten Hände. Zuletzt wurde die Krone gereicht und Erzbischof Ernst setzte sie dem König als zeremoniellen Höhepunkt auf das Haupt. Nach alledem wurde er vom Altar, wo er alle königlichen Insignien empfangen hatte, zurück zum Thron geführt. Hier gab er, königlich gewandet, gegürtet und gekrönt, das Gelöbnis an seine Untertanen ab: „Ich bekenne und verspreche, vor Gott und seinen Engeln, jetzt und in allen zukünftigen Zeiten, die Heilige Schrift, die Gerechtigkeit und den Frieden der heiligen Kirche Gottes und meiner Untertanen, nach Möglichkeit und Gewissen handzuhaben und auszuüben. Bei der Verwaltung des Königreiches meine Getreuen zu Rate zu ziehen, den Bischöfen und der heiligen Kirche alle gebührende Ehrerbietung zu zeigen und was den Kirchen von Königen und Kaisern gegeben wurde, zu erhalten. Ich gelobe auch, dass ich den Äbten, Herren, Rittern und Vladiken mit Achtung begegnen werde, so wie mir meine Getreuen anraten werden. Amen.“.
Karl war nunmehr ordentlich gewählter, gesalbter und gekrönter König Böhmens, Mährens, Schlesiens und der Lausitz.
Nach dem geschilderten Krönungsakt, war seine Frau Blanka Margarete an der Reihe. Auch sie wurde in gleicher Weise gesalbt, erhielt einen Ring, ein Zepter und bekam eine Krone aufs Haupt gesetzt. Nach Abschluss des Zeremoniells wurde sie von einer Äbtissin zum Thron geleitet und die Messe mit weiteren Lesungen aus der Schrift sowie symbolischen Opferleistungen des königlichen Paars fortgesetzt. Es folgte die Eucharistiefeier, abgeschlossen mit der Einnahme des symbolischen Leib Christi und seines Blutes, in Form von Brot und Wein.
Mit Beendigung der Messe begaben sich alle in die Prager Altstadt, die sogenannte große Stadt und stiegen im dortigen Rathaus ab. Auf dem öffentlichen Palast, vor der Sankt Gallus Kirche, war ein hölzernes, offenes Gebäude erbaut worden, wo das Herrscherpaar mit den Gästen zur Tafel saß. Die Ritterschaft bediente die Tafel zu Pferde, was ein Hinweis auf die Größe des Gebäudes gab. Ausklang nahm der Tag mit Turnieren und allerlei Spielen, Tanz und Zeitvertreib.
Karl zelebrierte seine Krönung völlig im Einklang mit seinen diesbezüglichen Ansprüchen. Dem versammelten Adel, Klerus und Volk führte es eindrucksvoll die Größe ihres Königs und des böhmischen Königreichs vor Augen. Die Kosten hierfür waren enorm und man darf nicht annehmen, dass Karl, der ja gerade erst von seinem endgültig missglückten Tirolfeldzug zurückgekehrt war, die Aufwände aus Ersparnissen bezahlt hätte, auch wenn durch die Verpfändung einiger verbliebener Tiroler Städte immerhin die gröbsten Kosten des Abenteuers gemildert wurden. Er lieh sich das notwendige Geld zur Feier selbstverständlich und musste entsprechend einiges verpfänden oder sogar ganz veräußern. Da Handel und Gewerbe in Böhmen im Aufschwung waren, die baulichen Maßnahmen in und um Prag fortwährend auch einen Zufluss von Geldern in die landesherrlichen Kassen brachten, war Karl für gewöhnlich in der Lage nach einiger Zeit die verpfändeten Güter oder Regale wieder einzulösen. Vielen fürstlichen Zeitgenossen gelang dies in Ermangelung ausreichender wirtschaftlicher Basis nicht in annähernd gleicher Weise.
Der Kaiser stirbt
Karl hielt sich nach der Krönung rund einen Monat in Prag auf und genoss die hohe Popularität beim böhmischen Volk. Vielleicht gelang es ihm für einige Zeit die Last der schwebenden Thronfrage im Heiligen Römischen Reich zur Seite zu schieben, doch schwerlich für lange. Im Laufe des Septembers ordnete er das Zusammenziehen eines Heeres in Taus (tschech: Domažlice) in bayrischer Grenznähe liegend, an. Er wollte die Initiative ergreifen und dem Kaiser zuvorkommen. Dieser sammelte seinerseits überall Verbündete gegen den anmaßenden Räuber des römisch-deutschen Throns. Bevor sich eine unüberwindbare Allianz gegen ihn verschworen hätte, wollte Karl einen heftigen Schlag ins Herz der kaiserlichen Kernlande wagen. Die Erfahrungen aus dem letzten, wenn auch kurzen Feldzug gegen Niederbayern, damals mit nur unzureichenden Kräften, als er selbst noch in Tirol stand, machten ihn zuversichtlich. Sehr wahrscheinlich konnte er durch einen kühn geführten Angriff die Verbündeten Ludwigs abschrecken, dessen bisherige Allianzpartner, Herzog Albrecht von Österreich und König Ludwig von Ungarn, noch keinerlei Anstalten machten ihm aktiv beizustehen. Bei einem erfolgreichen böhmischen Heerzug würden sie aller Voraussicht nach, aus Sorge um die eigenen Ländereien, in der Defensive bleiben, so Karls Annahme.
Am 13. Oktober traf Karl im Heerlager bei Taus ein. Er hatte seinen Bruder während seiner Abwesenheit zum Statthalter Böhmens bestellt und machte sich selbst auf einen längeren Krieg gefasst. Vor Ort angekommen, erwartete ihn die Nachricht, dass Ludwig IV. zwei Tage zuvor, am 11. Oktober 1347, während einer Bärenjagd einen Schlaganfall erlitt und noch an Ort und Stelle verstorben war. Welche Gedanken ihm darauf durch den Kopf gingen, ist nirgends festgehalten. Vielleicht erinnerte er sich an Auszüge des päpstlichen Bannbriefs wider den Kaiser, von vor einem Jahr, wo diesem in vielfältigen Flüchen von Clemens VI. der Tod herbeigewünscht wurde. Was immer er gedacht oder gefühlt haben mag, ob Genugtuung oder Erleichterung, der unerwartete Tod löste für den Augenblick die Thronfrage im Reich ohne Blutvergießen.
Karl war sich hinsichtlich des weiteren Vorgehens unschlüssig. Sollte er dennoch nach Bayern einmarschieren, um Ludwigs Söhnen, allen voran dem ältesten und gleichnamigen Sohn zu Leibe rücken? Er verblieb für einige Tage im Zustand des Abwägens. Die Entscheidung wurde ihm schlussendlich durch die eintretenden Umstände erleichtert. Unter den angeworbenen Truppen machte sich Unruhe breit, viele fürchteten der Krieg bliebe aus und somit die Aussicht auf Beutegut. Karl musste sich sorgen sie könnten bald auseinanderlaufen, ohne dass er einen effektiven Streich gegen Ludwig den Brandenburger geführt hätte und dann ohne Truppen dastehen. Aus dieser Situation heraus entschied er sich zum präventiven Schlag. Wider Erwarten traf er auf keinen Widerstand, worauf sich seine Kriegsknechte mit den wüstesten Plünderungen und Verheerungen einen fragwürdigen Namen machten. Er musste fürchten, dass sich im Reich herumspräche, er lässt ein sich nicht zur Wehr setzendes Fürstentum auf fürchterliche Weise heimsuchen, noch dazu, wo die Person, gegen die er ursprünglich zu Felde zog, nicht mehr lebte. Sein Ruf als Reichsoberhaupt würde beschädigt, noch bevor er überhaupt eine feste Stellung erlangte. Dem Treiben der marodierenden Söldner musste dringend ein Ende gesetzt werden. Seinen untergebenen Anführern gab er die Order, mit dem Großteil der Truppen zurück nach Böhmen zu ziehen und dort auf weitere Weisungen zu warten. Selbst zog er in relativ kleinem Kriegsgefolge erst nach Straubing und dann weiter in die Reichsstadt Regensburg, wo man ihn mit allen Ehren als den König und Oberhaupt des Reiches empfing. Es zeichnete sich der Anfang eines Paradigmenwechsels unter den Reichsstädten ab, jenen reichsunmittelbaren, nur dem Reichsoberhaupt unterstellten Inseln innerhalb der Ländereien der Territorialfürsten, Abteien oder Bistümer. Als Zentren von Handel und Handwerk waren die Reichsstädte wichtige Einnahmequelle für die königliche- bzw. kaiserliche Kasse, gleichzeitig starke Gegengewichte zu den immer autonomer agierenden Landesfürsten und damit ein wertvolles Balanceinstrument imperialer Innenpolitik.
Die Frage nach der tatsächlichen Haltung der Reichsstädte, zumal der großen und wichtigen, konnte am besten in Nürnberg beantwortet werden. Nürnberg war spätestens seit Beginn des vierzehnten Jahrhunderts zur einflussreichsten Reichsstadt im süddeutschen Reichsteil geworden. Karl zog von Regensburg nach Norden um sich dieser Stadt zu vergewissern.
Nürnberg und seine Burggrafen
Nürnberg stand lange im Schatten der einflussreicheren Stadt Fürth, gewann aber unter der Verwaltung der Burggrafen aus dem Hause Zollern, seit dem späten vierzehnten Jahrhundert Hohenzollern genannt, zunehmend an Bedeutung. Da das Haus Zollern, bzw. Hohenzollern für viele Generationen eng mit Nürnberg verbunden war und sie im Laufe der Zeit in Unter- und Oberfranken zu einflussreichen Territorialfürsten wurden, ist es angemessen hierzu noch einige ergänzende Anmerkungen zu machen.
Das burggräfliche Geschlecht der Hohenzollern stammt ursprünglich aus Schwaben, wo sie mit der gleichnamigen Burg ihren Stammsitz am nördlichen Ausläufer der schwäbischen Alb haben. Als frühe Parteigänger des ebenfalls schwäbischen Kaisergeschlechts der Staufer, blieben sie bezüglich kaiserlicher Dank- und Gunsterweisungen zwar hinter Häusern wie den Wittelsbachern oder dem jüngeren Zwei der Askanier, doch wurden ihnen nichtsdestotrotz im schwäbischen Raum eine Reihe von Privilegien zuteil. Da wir an dieser Stelle nicht die ganze Geschichte dieser Dynastie wiedergeben wollen, springen wir in das Jahr 1184. In diesem Jahr heiratete Friedrich III.,Graf von Zollern, mit Sophia von Raabs, die Erbtochter des Nürnberger Burggrafen Konrad II. von Raabs. Als Konrad 1191 ohne männlichen Erben starb, ging die Burggrafschaft an seinen Schwiegersohn Friedrich über, der nun als Friedrich I. von Nürnberg-Zollern, der erste Nürnberger Burggraf aus dem Geschlecht der Hohenzollern wurde. Mit dem Amt eines Burggrafen, was letztendlich nur eine Art hoher Reichsbeamter darstellte, waren gleichzeitig das Erbe einiger territorialer Erwerbungen im fränkischen Raum verbunden, wie auch in Niederösterreich, der ursprünglichen Heimat der Raabs. Als Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg waren nun weit auseinander liegende Gebiete zu verwalten. Nach dem Tod der Mutter, nahmen die beiden Brüder Konrad und Friedrich 1218 eine Teilung des Besitzes vor. Es entstanden die fränkische – und die schwäbische Linie, wobei der ältere Konrad sich das fränkische Gebiet vorbehielt und Friedrich die schwäbischen Stammlande zukamen. Beide Linien entwickelten sich fortan weitestgehend getrennt voneinander. Schon unter Konrads Administration erlangte Nürnberg große Autonomie, als Kaiser Friedrich II. im Großen Freiheitsbrief die Stadt reichsunmittelbar machte. Für die fränkischen Hohenzollern bedeutete es eine wesentliche Beschneidung der althergebrachten Verfügungsrechte in der Stadt, was gleichzeitig erhebliche finanzielle Auswirkungen hatte. Konrad grollte dem Kaiser dennoch nicht und blieb ein treuer Anhänger, auch in den schweren Zeiten, als der Kaiser im Kirchenbann lag und ihn sein ältester Sohn Heinrich im Reich bekriegte. Konrad gelang es in seinen Gebieten und damit auch zum besonderen Nutzen Nürnbergs, den Landfrieden zu bewahren, womit Handel und Gewerbe der Stadt aufblühten und das rivalisierende Fürth zwischenzeitlich an Einfluss längst überflügelt wurde. Für Burggraf Konrad sollte sich der zu Beginn schmerzlich einschneidende Nürnberger Freibrief im Nachhinein als eine heilsbringende Zäsur erweisen. Hierdurch konzentrierte er sich fast zwangsläufig vermehrt auf Territorialpolitik, statt auf das eigentliche Burggrafenamt. Durch käuflichen Erwerb, verbunden mit einer effektiven Spar- und Wirtschaftspolitik, vergrößerten sich die Anfangs noch bescheidenen Ländereien nach und nach. Eine wohlwollende Politik des Kaisers brachte darüber hinaus frühzeitig Privilegien an das Haus Hohenzollern, wie sie sonst meist nur bei den großen Reichsfürsten existierten, umgekehrt verschrieben sich Generationen von zollernschen Burggrafen den jeweiligen Häuptern des Reichs als treue Interessenverwalter einer imperialen Politik im fränkischen Raum. Die Treue zum jeweiligen Herrscherhaus, sparsame Haushaltung mit den eigenen Mitteln, stringente Erweiterung des eigenen Territoriums durch Zukäufe und ungewöhnliches Glück in der Hochzeitspolitik, förderte die Nürnberger Burggrafen weiter nach oben. Kein Burggrafengeschlecht in der gesamten mittelalterlichen Geschichte des Heiligen Römischen Reichs sollte sich solch eine Macht und Popularität erarbeiten.
Nürnberg, als freie Reichsstadt, profitierte von der maßvollen, den Landfrieden in der Gegend fördernden Politik der Burggrafen. Es erblühte kolossal und schloss zu den großen Reichsmetropolen Köln, Lübeck und Frankfurt auf. Einige Generationen akzeptierte das fortwährend selbstbewusster werdende Stadtpatriziat den noch verbliebenen Einfluss der Burggrafen auf das städtische Leben, bis es begann offen dagegen zu opponieren. Wir kommen darauf zu gegebener Zeit wieder zurück, und wenden uns jetzt wieder König Karl zu.
Karl IV. reiste also nach Nürnberg um die Huldigung dieser für den gesamten südostdeutschen Raum wichtigen Stadt einzuholen, als ein Signal und Beispiel für alle anderen freien Städte, nicht nur der Region, des ganze Reichs. Vor den Toren angelangt, fand er sie verschlossen, die burggräflichen Brüder Johann II. und Albrecht I. verweigerten ihm den Einlass. Sie waren Söhne Friedrich IV. von Hohenzollern. Jener Friedrich, der für den verstorbenen Kaiser Ludwig bei der Schlacht von Mühldorf durch seine überraschende Reiterattacke in die Flanke des habsburgischen Heeres, mit der Gefangennahme des Gegenkönigs Friedrich dem Schönen, 1322 die Entscheidung brachte und von Amtswegen ein Anhänger des bisherigen Kaisers war. Die große Loyalität zum jeweiligen Reichsoberhaupt ergab sich bei den Hohenzollern aus dem Amt des Burggrafen, das sie zum Schirmherr der Nürnberger Reichsburg machte. Eine tieferer Hang zu dieser oder jener Herrscherdynastie existierte nicht notwendigerweise, wenngleich es mitunter persönliche Präferenzen gab. Sie dienten offiziell gleichermaßen den Staufern, wie den Habsburgern, den Wittelsbachern oder davor den Luxemburgern. Jetzt, so kurz nach dem Tod des alten Kaisers, waren die beiden Burggrafen unschlüssig wie sie gegenüber dem Luxemburger König verfahren sollten. War er denn ihr König, war seine fragwürdige Wahl überhaupt rechtsgültig? Man stand vor einer schwerwiegenden Frage und es zeigt wie genau es die Amtmänner der Reichsinteressen in diesem Teil Frankens nahmen. Wobei wir ihre selbstlosen Dienste als neutrale Verwalter des Reichs nicht zu hoch loben möchten. Natürlich hatten auch die Burggrafen Sorgen im noch unklaren Thronstreit unter die Räder zu kommen. Wäre Karl mit einem größeren Heer vor die Stadt gekommen, es wäre ihnen sogar lieber gewesen, sie hätten sich ihm vermutlich leichteren Herzens angeschlossen. So aber war die Reaktion der Wittelsbacher Partei, die formell mit dem mächtigen Herzog Albrecht von Österreich und mit Ungarn, sowie einer Anzahl weiterer Fürsten verbündet waren, noch unklar. Welchen echten Zusammenhalt hatte diese Allianz, galt sie auch den Söhnen des Kaisers oder war sie mit seinem Tod hinfällig? Gab es schon neue Absprachen, über die man jetzt noch nicht wissen konnte? Leicht konnten alle errungenen Privilegien der vergangenen fünf Generationen verloren gehen oder empfindlich beschnitten werden. Ein Risiko vor dem die Nürnberger Burggrafen, mehr als andere Reichsbeamte ihrer Art, durch die zunehmende Wichtigkeit Nürnbergs, bei jedem Dynastiewechsel standen. Ihr vergangener Dienst dem Oberhaupt konnte im Falle eines Wechsels schnell das Missfallen des neuen Monarchen wecken. Bislang war es zwar noch immer gelungen den Übergang schadlos zu meistern aber es war keine Garantie für jetzt und die Zukunft.
Karl stellte sich auf freies Feld vor die Stadt und versprach den beiden Brüdern, dass er sie in all ihren Rechten und Freiheiten, so sie ihnen von Königen und Kaisern und vom Reich zugedacht waren, zu schützen. Für die Bürger der Stadt ein Spektakel, dass so noch nicht erlebt wurde. Die Tore der Stadt wurden geöffnet, die Entscheidung war gefallen. Johann und Albrecht traten vor Karl und leisteten ihm mit gebeugtem Knie den uralten Eid, ihm treu und gewärtig zu sein, als einem römischen König Gehorsam zu leisten als ihrem Herren, ihn gegen seine Feinde zu beschützen und beizustehen. Außer jene anwesenden Fürsten, die bei Karls Krönung in Bonn vor Ort waren, waren die beiden Hohenzollern Brüder die ersten Fürsten die Treueeid leisteten. Für Karl war es ein besonders wichtiger Schritt hin zur allgemeinen Anerkennung, er zeigte sich daher auch ungewöhnlich großzügig. Immerhin wäre es eigentlich zu erwarten, dass ein Vasall den Eid ohne weitere Zugeständnisse leistet, tatsächlich hatte es sich aber schon seit der Zeit des Interregnums eingeschlichen, dass sich die Fürsten ihre Treue mit klingender Münze oder sonstigen Zugeständnissen bezahlen ließen. Im Falle eines Thronstreits nahm diese Praxis in geradezu unanständiger, man möchte sagen skrupelloser Weise zu. Wie dem auch sei, er verschrieb den Burggrafen eine Summe von 14.000 Mark Silber, ferner tausend Pfund Silber in Hellern (Halbpfennig ursprünglich aus Hall) aus der Nürnberger Judensteuer. Unnötig zu erwähnen, dass Karl diese Summe nicht in bar zu leisten vermochte, entsprechend verpfändete er den Brüdern die Einkünfte von vier fränkischen Reichstädten. Doch nicht genug, er belehnte sie weiter mit einigen Dörfern, die der verstorbene Kaiser zuvor einem anderen Regionalfürsten gegeben hatte, was im Klartext bedeutete, sie mussten erst ihren zukünftigen Lehnsbesitz dem bisherigen Lehnsträger abringen. Abschließend versprach er ihnen noch ihre Rechte auf eine Reihe von Weg- und sonstigen Zolleinahmen, die sie noch vom Kaiser zugestanden bekamen, gegen die Wittelsbacher Partei zu verteidigen. Summiert man all die Zugeständnisse Karls auf, kann man sich einen Begriff davon ableiten, welche überragende Bedeutung die Lehnstreue der Stadt Nürnberg und der Burggrafen für ihn hatte. Die Hohenzollern dankten es ihm durch zukünftige Loyalität, zumindest meistens, denn es sollten noch Meinungsgegensätze auftreten, die auf Karls Heiratspolitik zurückzuführen waren, auf die wir noch zu sprechen kommen,
Der Stadt Nürnberg selbst wurden ebenfalls zahlreiche Rechte bestätigt und Zugeständnisse erteilt, so unter anderem ihre Reichsunmittelbarkeit, was gerade für die Patrizier, dem Stadtadel, sehr wichtig war, trugen sie doch längst die Sorge, die ambitionierten Hohenzollern könnten sich durch Geschick der Stadt nach und nach erneut bemächtigen.
Das Lager Karls wird größer
Karl blieb den ganzen Monat November 1347 in Nürnberg, fertigte zahlreiche Urkunden aus und vergaß dabei auch nie sein böhmisches Königreich. Der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber, die seit geraumer Zeit immer wieder von lokalen Fürsten bedrängt war, bestätigte er die Freiheiten, stärkte damit ihre Autonomie und gab allen zukünftigen Aggressoren ein klares Signal. Straßburg, das sich noch im letzten Jahr widerspenstig zeigte, gewährte er Zugeständnisse, um die wichtigste elsässische Stadt dadurch für sich zu gewinnen. Am 24. November leisteten ihm die Brüder Graf Eberhard II. (nach 1315 – 1392) und Graf Ulrich IV. von Württemberg (nach 1315 – 1366) sowie die Brüder Friedrich I. von Hohenlohe (vor 1320 – 1352), Fürstbischof von Bamberg und Albrecht II. von Hohenlohe (vor 1320 – 1372), Bischof von Würzburg, den Treueeid und bekamen ihrerseits große Geldsummen angewiesen. Im Falle der Württemberger Grafen waren es 70.000 Gulden und für die Herren von Hohenlohe jeweils 20.000 Gulden. Die Grafen von Württemberg spielten ein doppeltes Spiel. Sie loteten aus, ob Ludwig der Brandenburger, des verstorbenen Kaisers ältester Sohn, gegebenfalls für ihre Unterstützung noch generöser wäre. Und tatsächlich war dieser bereit sogar 100.000 Gulden zu zahlen, allerdings war der ausgesandte Bote an König Karl früher zurück und so entschieden sie sich für die vermeintlich hohe Summe des Luxemburgers, um sich im Anschluss über die eigene Hast zu ärgern. Gier frisst Geld, sagt der Volksmund.
Anfang Januar 1348 verließ Karl Nürnberg Richtung Westen und begab sich nach Schwaben, wo er u.a. in Schorndorf und Pforzheim allerlei Gnadenbriefe und Urkunden ausstellte. Von hier reiste er weiter ins Elsass und begab sich nach Hagenau, das er am 9. Januar erreichte und wo er zwei Tage verweilte, um anschließend nach Straßburg weiterzureisen. Bischof Berthold von Straßburg, wechselseitiger Parteigänger des verstorbenen Kaisers und dann wieder des Papstes, hatte die Abgesandten der Elsässer Reichsstädte hier versammelt und war bemüht sie von Karl zu überzeugen. Die meisten Vertreter waren skeptisch. Nicht dass sie kategorische Gegner Karls waren, sie fürchteten der Städtebund, der bisher höchst erfolgreich den Landfrieden in der Region garantierte, könnte durch Parteiungen untereinander ernstlich gestört werden. Letztlich konnte Berthold sie überzeugen, nicht zuletzt, weil er und eine Reihe der zum Bund gehörenden Grafen sich in aller Klarheit und freimütig zu Karl bekannten.
Als Karl am 12. Dezember 1347 in die Stadt einritt, wurde er ehrenvoll von den Versammelten empfangen. Der Bischof, der ihm huldigte und als römisch-deutschen König anerkannte, wurde von ihm vor allem Volk auf den Stufen des Münsters mit den Regalien eines fürstbischöflichen Landesherren belehnt. Als besondere Auszeichnung und Schauspiel aller Augenzeugen, trug er dabei Krone, Zepter und Reichsapfel. Anmerkung: Um die originalen Reichskleinodien konnte es sich nicht handeln, diese befanden diese sich zu dieser Zeit noch in den Händen von Kaiser Ludwigs ältestem Sohn Ludwig. Selbstverständlich waren es auch nicht die böhmischen Königsinsignien, da diese außerhalb Böhmens keinerlei symbolische Bewandtnis hatten. Es handelte sich sehr wahrscheinlich um eine relativ einfache Goldkrone, ganz sicher nicht so prachtvoll gefertigt und reich bestückt wie das Original. Mit Sicherheit waren es jene Stücke, die Karl schon bei der Krönung in Bonn benutzte.
Was die skeptischen Städte auf die Linie Karls einschwenken ließ, war sein Versprechen sich beim Papst für sie zu verwenden. Sie standen, weil alle bisher besonders treue und langjährige Anhänger des gebannten Kaisers waren, ebenfalls unter dem päpstlichen Kirchenbann, unter dem Interdikt. Der Zorn der Päpste, begonnen bei Johannes XXII., über Benedikt XII., bis Clemens VI. auf jeden, der es mit dem Wittelsbacher König und späteren Kaiser hielt, hatte teilweise irrationale Züge. Das jeweilige Oberhaupt der Kirche missbrauchte auf eklatante Weise seine Macht zur Durchsetzung politischer Interessen und stürzte auf diese Art während der Regentschaft Ludwigs IV. hunderttausende Menschen in eine seelische Notlage.
Karl hatte schon zeitig nach des Kaisers Tod eine Abordnung nach Avignon gesandt, um die Nachricht vom Ableben Ludwigs zu überbringen, wie auch von den ersten Erfolgen in Nürnberg. Er ersuchte in einer beigefügten Bittschrift um die Vollmacht Bischöfe des Reichs zu autorisieren den päpstlichen Bann gegen jene Städte und Regionen aufzuheben, die wegen ihrer früheren Treue zum Kaiser beim Papst in Ungnade gefallen waren. Allein das Beispiel des Elsass, dessen zahlreiche Reichsstädte alle dem Interdikt unterlagen, zeigte auf drastische Weise die großräumigen Dimensionen. Die Forderungen der jeweiligen Städte waren nahezu gleichlautend, neben der üblichen Bestätigung althergebrachter Regalien, war die Lösung vom Kirchenbann eine ihrer Hauptbedingungen ihrer Unterwerfung. Sie erwarteten von Karl wegen seiner bekanntermaßen innigen Vertrautheit zu Clemens VI., dass dieser sich für sie erfolgreich einsetze. Karls Delegation bestand aus Probst Marquard von Bamberg, Nikolaus von Luxemburg, Probst zu Garz und dem Domherrn zu Prag.
Karl hatte, aus Straßburg kommend, in Schlettstadt Zwischenstation gemacht, wo er der dieser Stadt wie auch Colmar, Mühlhausen, Münster, Thüningheim, Kaisersberg, Ebenheim und Roßheim die Garantien als Reichsstadt bestätigte. Am 20. Januar traf er in Basel ein, das ihn in allen Ehren begrüßte, die Huldigung aber ausdrücklich mit der vorgenannten Bedingung verbanden. Der um Anerkennung ringende König traf die Rückkehrer aus Avignon vor Basel an, ein zunächst glücklicher Umstand. Sie hatten eine an den Erzbischof Ernst von Prag und an Friedrich von Hohenlohe, den Fürstbischof von Bamberg, gerichtete Bulle bei sich. Clemens VI. verlieh darin beiden kirchlichen Würdenträger das Recht den Bann zu lösen, wenn die im Schreiben aufgelisteten Bedingungen zuvor von den zu Erlösenden beschworen wurden. Erzbischof Ernst gehörte nicht zu den Begleitern Karls, wohl aber der Bamberger Bischof Friedrich. Bislang war der genaue Wortlaut der noch versiegelten Urkunde unbekannt, nach Öffnung und Verlesung im kleinen Kreise, sorgte er unter den Anwesenden und besonders unter dem König für Bestürzung. Kurz zusammengefasst forderte der Papst darin unter anderem das alleinige Approbationsrecht, nur er durfte einen gewählten römisch-deutschen König benennen. An dieser Grundsatzfrage entzündete sich nach der Wahl Ludwigs IV. seinerzeit der Komflikt mit Johannes XXII., dem ersten in Avignon residiernden Papst. Das Reich stellte sich in der vom Kurverein zu Rhense beschlossenen Resolution hinter den Monarchen, was den päpstlichen Nachfolger Benedikt XII. nicht zum Einlenken, wohl aber zum diplomatischen Rückzug in dieser Frage zwang. Papst Clemens VI. nahm nun diesen Punkt erneut auf. In der Zuversicht sein einstiger Zögling Karl würde sich fügen, startete er einen neuen Generalangriff auf die Souveränität des Kurvereins, des römisch-deutschen Königs und Kaisers in spe und nicht zuletzt auf das Reich selbst. Karl war in einer äußerst misslichen Lage. Zur Durchsetzung eines unangefochtenen Anspruchs auf die Reichskrone durfte er keinesfalls die Souveränität des Herrschaftsamtes und noch weniger des Reichs beschneiden lassen oder gegen solche Versuche widerstandslos bleiben. Umgekehrt war da die Freundschaft und ehrliche Loyalität zum väterlichen Freund Pierre Roger, dem zwischenzeitlich zum Papst erhobenen Lehrmeister aus den prägenden Jahren seiner Zeit am französischen Königshof. Ein einvernehmliches Verhältnis zum Papst zu behalten, war schon vor dem Hintergrund des Langzeitziels, der Erwerbung der Kaiserkrone, geradezu elementar.
Er ließ erneut nach Avignon schicken, die Bedingungen zu mildern, es waren neben dem genannten, noch eine Reihe weiterer Positionen die nicht weniger problematisch waren. Bis eine Antwort dort einträfe, konnte er unmöglich in Basel verweilen, einerseits weil ihm grundsätzlich dazu die Zeit fehlte, andererseits weil die Bürger der Stadt einen Aufruhr probten. Gedrängt von der fortschreitenden Zeit und dem Druck der Stadt, ließ er die päpstlichen Bedingungen verlesen. Unter den Zuhöreren regte sich augenblicklich großer Unmut. Konrad von Bärenfels (1305 – 1373) Bürgermeister Basels trat aus der Menge und wandte sich an den vorlesenden Bamberger Bischof: „Wisset, Herr Bischof, dass wir weder glauben noch bekennen wollen, dass der Römische Kaiser Ludwig jemals ein Ketzer gewesen sei. Wen immer uns die Kurfürsten oder der größte Teil davon zum Römischen König oder Kaiser geben, den wollen wir auch dafür halten und erkennen, wenn er auch vom Papste nicht bestätigt wäre. Wir werden nie etwas tun, was wider die Rechte des Reichs sein könnte. Habt ihr aber die Vollmacht vom Papste, uns von unseren Sünden loszusprechen, so tut uns diese Gefälligkeit.“.
Nach diesen Worte drehte er sich zum anwesenden Volk und holte deren Erlaubnis ein, gemeinsam mit einem weiteren Bevollmächtigten, im Namen der Stadt den Eid zu Loslösung vom Kircheninterdikt zu leisten. Bischof Friedrich von Bamberg, in Begleitung eines päpstlichen Geheimschreibers, nahm beide zur Seite, und nahm das Gelöbnis ab. Es ist nicht bekannt ob auf die päpstlich festgeschriebenen, eigentlich unannehmbaren Formeln oder auf eine Kompromissformel, auf die man sich einigen konnte, die Annahme liegt immerhin nahe.
Nachdem die Stadt vom Bann gelöst war, somit das kirchliche Leben wieder praktiziert werden konnte, huldigte Konrad von Bärenfels im Namen Basels dem König nach der überlieferten Formel. Für Karl war dies ein weiterer, wichtiger Baustein zur Festigung seines Herrschaftsanspruchs. All dies geschah am 24. Dezember 1347. Am darauffolgenden Weihnachtstag, laß der König anlässlich der überfüllten Messe, aus dem Evangelium, während er als Zeichen seiner königlichen Macht ein Schwert in Händen hielt.
Am 27. Dezember begab er sich in Basel auf ein Rheinschiff und fuhr damit nach Norden. Interessanterweise besuchte er nicht weitere wichtige Städte wie Zürich, Bern oder Luzern. Es wäre durchaus angebracht und notwendig gewesen, standen diese Städte ihm bislang widerstrebend gegenüber doch noch wichtigere Angelegenheiten weiter im Norden riefen ihn ab. Über Hagenau nahm er den Landweg nach Speyer, wo er am Neujahrstag eintraf, einige Tage verweilte. Möglicherweise wäre er wegen der winterlichen Bedingungen noch etwas länger geblieben, doch erregte er in Speyer die Gemüter vieler Bürger und auch Personen aus der Geistlichkeit, denn er ließ öffentlich eine Reihe von Anklagen gegen den 1346 abgesetzten Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg verlesen, der in Speyer noch über viele Anhänger verfügte. Die Lage wurde dem König zu heikel, weswegen er den Weg nach Worms fortsetzte, das bis dahin ebenfalls zu den vielen gebannten reichsstädtischen Anhängern des vormaligen Kaisers gehörte. Der Bamberger Bischof löste auch diese Stadt kraft seiner vom Papst erteilten Autorität vom Interdikt, worauf sie dem König huldigte und ihre Rechte und Privilegien bestätigt bekam. So leicht wie dieser eine Satz es suggerieren mochte, verhielt es sich aber nicht, denn es kam auch in Worms zu einer äußerst ernsten Empörung. Zunächst löste nämlich Bischof Friedrich von Bamberg nur die örtliche Geistlichkeit vom Bann , worauf eine nichtöffentliche Messe begonnen wurde. In Windeseile raffte sich eine große Menge bewaffneter Bürger zusammen, die vor den Dom zogen und den Bischof drohend aufforderten, sie ebenfalls vom verhassten Bann des Papstes zu lösen. Der Bischof floh in das gut bewachte Haus, in dem der König untergebracht war, worauf sie auch dieses Gebäude umstellten und Anstalten machten es zu stürmen. Karl wies ihn an auch die Bürger von der Last des päpstlichen Fluchs zu befreien. Sofort löste sich der Tumult auf und die Situation war bereinigt. Karl legte es dennoch nicht darauf an, die hitzige Szenarie des Vortages und die Erfahrungen aus Speyer, ließen ihn vorsichtig werden, er verlies somit gleich am kommenden Morgen Worms Richtung Mainz, wo er nicht nur mit dem größten Widerstand rechnete, sondern auch echte Sorgen hatte, es könnte sich aus dieser Region eine ernstzunehmende Opposition entwickeln. Auf seinem ganzen Weg von Basel, über Hagenau, Speyer und Worms, hatte er sich seine Strategie zurechtgelegt. Ihm war längst klar geworden, dass die vom Papst betriebene Absetzung des alten Mainzer Erzbischofs und die Einsetzung des jungen Gerlach von Nassau, ihm zwar die Stimmenmehrheit in Kurfürstenkollegium und somit seine Wahl zum römisch-deutschen König einbrachte, dass aber große Teile der Mainzer Kirchenprovinz, die mit weitem Abstand größte im gesamten Heiligen Römischen Reich, die Absetzung nicht akzeptierte und den neuen Erzbischof nicht anerkannten. Sein eigener Entschluss war getroffen, er würde weder die Vorwürfe gegen Heinrich von Virneburg vorlesen lassen, die Erfahrungen aus Speyer waren ihm Lehre genug, noch die Einsetzung des neuen Erzbischofs durchsetzen. Hier stand er nun erstmals in völligem Gegensatz zu Papst und dies, obwohl er der Hauptnutznießer der Einsetzung Gerlachs von Nassau war. Man konnte nur gespannt sein, wie der Papst dies aufnehmen würde. In Mainz eingetroffen, traf er seinen Großonkel Balduin, den Erzbischof von Trier, der mit einer kleinen Schar angereist kam, um sich mit ihm zu besprechen, denn es zogen Wolken am Himmel auf.
Die Opposition rührt sich
Karls Gegner planten die Wahl eines Gegenkönigs. Aus ihrer Sicht war jetzt, nachdem das alte Reichsoberhaupt verstorben war, ünerhaupt erst die Legitimität zur Königswahl gegeben. Die Wahl Karls erkannten sie bekanntlicherweise nicht an. Vier Kurfürsten trafen sich zur Beratung im unweit entfernten Oberlahnstein, gegenüber von Rhens. Es waren streng genommen die beauftragen Vertreter von vier Kurfürsten wovon zwei, je nach Betrachtung, nur vermeintliche Kurfürsten waren. Versammelt waren die Abgeordneten des Mainzer Erzbischof, jenes abgesetzten Metropoliten über den wir nun schon vielfach schrieben, ferner ein Vertreter des Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, des Herzogs Erich von Sachsen-Lauenburg und zu guter Letzt, ein Abgesandter des Markgrafen Ludwig von Brandenburg. Einige Sätze noch zu Herzog Heinrich. Spätestens seit des seinerzeitigen Regierungsantritts von Ludwig IV., stritten die beiden askanischen Häuser Sachsen-Wittenberg und Sachsen-Lauenburg um die rechtmäßige Ausübung des Kurrechts. Unsere eigene Sicht wurde in Buchs 2 geäußert. Die ältere Linie Sachsen-Wittenberg, vertreten durch Herzog Rudolf I., war der nach überliefertem Rechter, der legitime Halter des Kurprivilegiums. Die ungerechtfertigten Ansprüche der Linie Sachsen-Lauenburg machten sich nichtsdestotrotz die Widersacher Karls zu eigen.
Die am 10. Januar 1348 stattgefundene Beratung in Oberlahnstein, brachte keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen hervor. Des verstorbenen Kaisers ältester Sohn stand seit seiner Heirat mit Margarete von Tirol unter Kirchenbann und konnte nicht gewählt werden, so gerne er das auch gewollt hätte. Auch sonst konnte man sich nicht auf einen Fürsten aus dem Reich einigen, worüber man ein wenig den Kopf schütteln möchte, hätte sich doch mit dem Habsburger Herzog Albrecht II. von Österreich, ein Kandidat geradezu aufgedrängt, was aber nicht im Sinne der Wittelsbcher Partei war. Stattdessen beschlossen die vier Vertreter, König Eduard III. von England die Krone des Reichs anzubieten. Erinnerungen an die Wahl Richards von Cornwall im Jahre 1257, kommen hier unwillkürlich in den Sinn.
Für Karl ergab sich aus diesem Sachverhalt eine bedrohliche Situation. Seit Eduards vernichtendem Sieg bei Crécy, im Sommer 1346, bei dem er nicht nur den Vater verlor, sondern auch mit dem erheblich geschwächte Frankreich, den mächtigsten realen bisherigen Verbündeten, war er, abgesehen vom Papst, auf sich und seine eigene Hausmacht gestellt. Nachdem die Engländer im August des Vorjahres, nach einjähriger Belagerung, auch noch Calais wegnahmen, schien es fraglich wie lange sich der König von Frankreich noch auf dem Thron der Karpetinger halten konnte. Er sandte eine hochrangige Delegation an den englischen Hof, geführt vom Grafen Wilhelm I. von Jülich (1299 – 1361), um dem König dringend von der Annahme der angebotenen römisch-deutschen Krone abzuraten.
Während in England die Verhandlungen liefen, reiste Karl von Mainz wieder nach Süden, nach Schwaben, wo im Vorjahr zwar vordergründig zahlreiche Städte und Grafen im huldigten, zwischenzeitlich deren Feuer für ihn aber wieder am erlöschen war. Er musste zur Auffrischung noch einmal eine Rundreise vornehmen. In Rottenburg am Neckar wurde ihm zu Ehren ein großes, zweitäges Turnier abgehalten. Von hier zog er entlang der Donau nach Ulm, das er am 26. Januar erreichte und wo sich die Vertreter von 24 Reichsstädten einfanden und ihn als ihrem König und Herren huldigten. Er überhäufte sie regelrecht mit Zuwendungen und großzügigen Bestätigungen ihrer Privilegien. Unter diesen Städten waren Augsburg, Esslingen, Kaufbeuren, Hall, Heilbronn, Leutkirchen, Memmingen, Kempten, Weil, Lindau, Rottweil, Wimpfen und weitere.
Nach vielen Monaten des Aufenthalts im deutschen Reichsteil, war es an der Zeit in sein böhmisches Königreich zurückzukehren. Er wollte hierzu den kürzesten Weg, die große Handelsstraße nutzend, über Nördlingen und Nürnberg, nach Eger nehmen. Schon kurz nach Ulm lauerten ihm bewaffnete Gruppen Ludwigs auf. Gemeint ist hier jetzt stets Markgraf Ludwig I. genannt der Brandenburger, gleichzeitiger Herzog Ludwig V. von Bayern und Graf von Tirol. Sollten wir rückblickend von seinem Vater Ludwig IV., dem vormaligen Kaiser oder vom gleichnamigen, nächstjüngeren Bruder Ludwig dem Römer sprechen, ist immer, zur eindeutigen Unterscheidung, ein etwaiger Zuname oder Titulatur angegeben.
Wie gesagt, kaum war er in Begleitung von Herzog Rudolf von Sachsen und Erzbischof Gerlach von Nassau, sowie einiger böhmischer Ritter aus dem städtischen Einflussbereich gereist, lauerten die ersten Gruppen ihn auf, in der Hoffnung ihn gefangen zu nehmen. Er und seine Begleitung mussten nach Ulm umkehren und einen alternativen Umweg suchen. Mit Glück erreichten sie glücklich am 12. Februar das Gebiet der Nürnberger Burggrafen. In Nürnberg hielt er sich bis zum 17. des Monats auf, wollte sich hier von den bisherigen Strapazen erholen, wurde aber von den Ereignissen in der Stadt zum Aufbruch gezwungen. Ludwig hatte in den zurückliegenden Monaten in Nürnberg viele Anhänger gewinnen können, sei es durch Geld oder durch Versprechungen. Die Burggrafen, deren Macht innerhalb der Reichsstadt selbst, schon seit Friedrich II. beschnitten waren, hatten keine Handhabe jenseits ihrer engen Restprivilegien in Nürnberg, ihnen standen beispielsweise keine Truppen im Stadtgebiet zur Verfügung, außer der kleinen Burgbesatzung in der sogenannten Grafenburg, um den König ausreichend im Bedarfsfall zu schützen. Er verließ Nürnberg Richtung Bamberg, fertigte einige Urkunden und Briefe aus und begab sich am 19. Februar endlich auf die letzte Reisetappe Richrung nach Böhmen. Eger erreichte er am folgenden Tag und stellte der Stadt, die einst ebenfalls eine freie Reichsstadt war, dann aber ihre Unabhängigkeit verlor und an Böhmen fiel, umfangreiche Freiheiten aus, in Anerkennung für ihre bislang bewiesene Treue. Immerhin wäre es für die Stadt ein verlockendes Ziel gewesen, durch Anknüpfung an die bayrische Partei Ludwigs, ihren alten Status wieder zu erwerben, doch sie blieb der böhmischen Krone loyal.
Karl erreichte seine Hauptstadt Prag vermutlich in den letzten Februartagen, genauer kann es nicht gesagt werden, denn die ersten von ihm in Prag ausgestellten Urkunden sind auf den 1. März datiert. Er blieb für einige Monate in Prag und ordnete eine Vergeltungsaktion gegen seine Gegner an. Er ließ Truppen anwerben um in der Oberpfalz, den bayrischen Läündereien des Pfalzgrafen bei Rhein, plündern und rauben zu lassen. Gerne geben die dem böhmischen König wohlgesonnenen Chronisten diesen wiederholt vorgenommenen Aktivitäten den Nimbus eines Feldzugs, mit dem Ziel den Gegner in einer Schlacht ehrenvoll zu bekriegen. Augenscheinlich ist dann immer die Angabe, man wäre auf keinen Widerstand gestoßen, worauf der Rückzug nach einiger Zeit angetreten wurde. Sehr wahrscheinlich war jedoch, dass die von Karl geführten vermeintlichen Feldzüge überhaupt nur der Schädigung und Verheerung der Landschaften seiner Gegner dienten. Wieso hätten seine Gegner ihr Gebiet immer aufs Neue völlig kampflos einem marodierenden Feind überlassen sollen? Die unschmeichelhafte Tatsache dürfte gewesen sein, sobald die lokalen Vasallen sich gesammelt hatten, um sich den böhmischen Plünderscharen und Mordbrennerbanden zu stellen, zogen diese sich mit ihrer Beute zurück und schlugen an einem anderen Tag, an anderer Stelle erneut zu. Karl verfolgte mit dieser zwar wenig ehrbaren, aber effektiven Strategie, vermutlich im wesentlichen zwei Ziele. Zum ersten die Gegner an ihrer ökonomischen Basis zu schädigen und dabei im besten Fall selbst Vorteile daraus zu ziehen und zum zweiten, eine immer schnell zusammengestellte Truppe bezahlter Kriegsknechte in Böhmen abrufbereit zu halten. Kriege dieser Art wurden zu großen Teilen, zumindest was das einfache Fußvolk betraf, mit Beutelschneidern, Gaunern, entwurzeltem Gesindel aller Art geführt. Nur die quasi von Berufswegen dem Kriegshandwerk verschriebenen Kämpfer, die Ritterschaft, samt ihren jeweils mitgebrachten Knechten, zumeist kaum mehr als eine Handvoll pro Ritter, der Hochadel mit seinen Kontingenten, sowie Spezialisten wie Bogen- oder Armbrustschützen, verhielten sich diszipliniert und nach gewissen Regeln allgemeingültiger Kriegsbräuche. Da Karl über faktisch keine Verbündeten verfügte, soll die Kritik nicht übermäßig hart gegen ihn ausfallen, auffällig bleiben die angewandten Strategien bei seinen Kriegszügen gleichwohl. Er war in dieser Hinsicht mit dem 1346 im Kampf gefallenen Vater überhaupt nicht zu vergleichen.
Prag wird zum Mittelpunkt
Karl war in vielem anders, nicht nur anders als der Vater, auch anders im Vergleich zu sonstigen Zeit- und Standesgenossen. Sein Interesse für Bildung, Handel und Wirtschaft, Bergbau, Theologie und mehr, war vielleicht nicht universell, denn ein Genie war er freilich nicht, doch die Kombination seiner Talente, seines angelernten Könnens und Wissens sowie seiner spezifischen Charaktermerkmale, schuf einen Typus Monarch, der seinesgleichen suchte und er stand erst noch am Anfang seines Wirkens.
Über die Pläne Karls, Prag durch den Bau einer Neustadt zu erweitern, haben wir schon gesprochen. Nach den Regeln der Zeit, waren solche Maßnahmen keine Erweiterung sondern zatsächlich eine städtische Neugründung in unmittelbarer Nähe, oft auf den Gemarkungen einer bereits existierenden Stadt. Verständlich, dass man dort, darüber für gewöhnlich nicht glücklich war. Im Falle Prags, das schon jetzt aus eigentlich zwei Städten bestand, der sogenannten großen Stadt und demgemäß der kleinen Stadt, getrennt durch die Moldau, war das nicht anders. Karl musste daher Absprachen treffen und Zusagen eingehen, um den Unmut der alten Prager Stadt, der nachmaligen Altstadt nicht zu schüren. Im März 1348 ging er das Vorhaben mit großer Energie an.
Die zukünftigen Bewohner der Prager Neustadt wurden mittels eines Gnadenbriefs für die nächsten zwölf Jahre von den königlichen Abgaben entbunden, es beinhaltete explizit auch Juden, die hierdurch gezielt angelockt werden sollten. Ausgenommen waren Bewohner aus den bisherigen Prager Städten, besonders der Altstadt. Hierdurch sollte verhindert werden, dass ein großer Exodus finanzielle Ausfälle brächte. Weiter verfügte er den Umzug der meisten Handwerksbetriebe, deren Arbeit besonders lärmend waren, dazu gehörten alle Bierbrauer, Wagner, Schmiede, Klemptner, Zimmerleute etc., ausgenommen hiervon waren nur die Waffen- und die Hufschmiede.
Karl war so enthusiastisch und erfüllt, dass er bei den Planungen und Vermessungen mit größter Freude selbst Hand anlegte. Er half beim ausmessen der Gassen, legte die Stellen der öffentlichen Plätze fest, auch die Positionen der Stadttore und selbstverständlich setzte er höchstpersönlich den Grundstein zu Stadtmauer.
Die vermutlich bedeutenste bauliche Neugründung seiner Regierungszeit, erfolgte am 7. April 1348. Karl hatte sich Ende Januar 1347 bei Papst Clemens VI. die Erlaubnis eingeholt, eine eigene Universität in seinem Reich zu gründen. Durch Karls monatelangen Huldigungsreisen durch den südwestdeutschen Raum, konnte das Vorhaben nicht unmittelbar in Angriff genommen werden, doch jetzt schien ihm der richtige Moment gekommen. Die Alma Mater Carolina, die Karls-Universität, wird die erste zentrale Lehranstalt Mitteleuropas werden und gewaltigen Einfluss auf die weitere Entwicklung und die bald schon einsetzende Blüte Prags nehmen. Gleichzeitig wird sie Initialzündung für weiterere Universitätsgründungen im deutschen Reichsteil sein. Ihr folgten in den nächsten 50 Jahren zunächst, 1365 Wien, 1379 Erfurt, 1386 Heidelberg, 1388 Köln, 1402 Würzburg, 1409 Leipzig.
Karls Autorität im Reich wächst
Wir wissen nicht welche Bedingungen, Angebote oder Drohungen die Mission des Grafen von Jülich im Einzelnen beinhaltete. Fest steht, schon am 10. Mai 1348 verzichtete Eduard III. von England er auf die ihm angebotene römisch-deutsche Krone. Das englische Parlament hatte ihn davon abgeraten. Die Vermutung ist höchst naheliegend, dass Karl ihm zuvor im Geheimen zusicherte, im anglo-französischen Krieg nicht auf der Seite des befreundeten Frankreichs zu intervenieren. Eduard, der zunächst dem Gedanken die Krone zu akzeptieren, sehr zugetan war, überdachte das für und wider. Die Eröffnung eines oder mehrerer neuer Kriegsschauplätze, zumal im für ihn entlegenen Reich, war zu riskant, der Ausgang zu ungewiss und die Kosten vor dem Parlament nicht begründbar.
Karl wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts über den Ausgang der Verhandlungen,. Er befand sich weiterhin in seinem böhmischen Königreich, verschanzte sich dort aber nicht, sondern pflegte eifrige Korrespondenz mit seinen bisher bereits gewonnene Reichsvasallen. Zu den ganz besonders engen Vertrauten wurde der sächsische Kurfürst, Herzog Rudolf. Dieser hielt sich jetzt vornehmlich unmittelbar bei Karl auf, sei es auf dessen Reisen oder am Hof in Prag. Rudolf avancierte in kurzer Zeit zu einem seiner wichtigsten Ratgeber in Reichsangelegenheit und bildete mit seinem Herzogtum einen wichtigen Brückenkopf in den norddeutschen Raum hinein. Im fränkischen Raum sorgten der Fürstbischof von Bamberg und die Burggrafen von Nürnberg für Stabilität. Ganz im Westen, entlang des Rheins bis an die Grenze zu den weitgestreckten Ländereien des opositionellen Pfalzgrafen bei Rhein, hielten die elsässischen Reichsstädte von Weißenburg und Metz im Norden, über Hagenau, Straßburg, Colmar im Zentrum bis hinunter nach Mühlhausen die Balance. Rechts des Rheins waren die Grafen von Württemberg wechselhaft und unzuverlässig aber auch dort sorgten dutzende schwäbische Reichsstädte für ein deutliches Übergewicht und waren ein Stachel an Grenze zum verfeindeten Herzogtum Bayern. Je weiter es aber in den Norden ging, je weniger wurden die Parteigänger Karls. Einen Vorteil konnte sein Widersacher Ludwig daraus dennoch nicht ziehen, denn auch ihm gegenüber blieb man dort weitestgehend gleichgültig, und selbst die Halbbrüder in den Niederlande, waren zeitweise mehr auf Neutralität aus, denn auf Wahrung der Wittelsbacher Hausinteressen. Was machte Karls Intimfeind Kasimir von Polen? Der Ausdruck ist zwar übertrieben, aber seit dem Entfürungsversuch Karls anlässlich seiner Rückreise aus dem Baltikum, war das Vergältnis zerrüttet. Nach dem böhmischen Vergeltungsschlag und dem polnischen Debakel in Krakau, verhielt er sich, trotz eindeutigem Bündnisbekenntnis zu Ludwig, Karls Widersacher, auffallend ruhig. Die Erklärung dazu ist aber einfsch, Kasimir war andersweitig schlichtweg beschäftigt. An seiner südöstlichen Grenze ergaben sich erhebliche Möglichkeiten der Erweiterung und das ohne in Konflikt mit mächtigen Allianzen zu geraten, die eine polnische Vergrößerung eifersüchtig beäugten. Kasimir war somit, in der kritischsten Phase dieses bislang unentschiedenen Thronkriegs, ungefährlich. Dann war da noch Ludwig I. von Ungarn. Verfeindet war Karl mit seinem Schwiegersohn eigentlich nicht, die Interessenskonflikte der beiden unmittelbar benachbarten Königreiche, führten allerdings zwangsläufig zu Reibereien. Wie dem auch sei, auch Ungarn war für den Moment mit anderen Querelen beschäftigt. Zunächst im eigenen, von vielen Landsmannschaften besiedelten Reich, dann mit dem sehr mächtig gewordenen Venedig im Streit um Dalmatien und ganz im Süden kündeten sich epochale Veränderungen an, die in nicht mehr ferner Zukunft das Gesicht des Balkans und die Politik des christlichen Abendlandes auf Jahrhunderte bestimmen wird. So blieb als gefährlichster Verbündeter Ludwigs, noch Herzog Albrecht II. von Österreich übrig, der sich bislang überhaupt völlig still verhalten hatte. Unter dem alten Kaiser Ludwig IV. dem Bayer, konnten die Habsburger ihre bisherigen nieder- und oberösterreichischen Gebiete im Südosten des Reichs, mit kaiserlicher Duldung, ja regelrechter Absprache, flächenmäßig fast verdoppeln. Nachdem von ursprünglich sechs Söhnen, des 1308 ermordeten römisch-deutschen Königs Albrecht I., mittlerweile nur noch sein gleichnamiger Sohn Albrecht lebte, er trug den Beinamen der Weise, war dieser zum größten Territorialfürsten im Heiligen Römischen Reich aufgestiegen. Er löste darin die Luxemburger vom Spitzenplatz ab, das seit dem Tod Johanns von Böhmen, durch Erbteilung in zwei Linien geteilt wurde und die Luxemburger Stammlande von Böhmen abgetrennte. Früh versuchte Karl den Gegensatz mit dem Hause Habsburg durch eine Heirat zu entschärfen. Tatsächlich kam die Initiative dazu von Albrecht selbst, der für seinen ältesten, damals erst fünfjährigen Sohn um die Hand der Prinzessin Katharina, Karls zweiter Tochter, anhalten ließ. Keine Frage war dies ganz im Sinne des damaligen Kronprinzen Karl, weswegen man sich schnell über die Formalitäten einig wurde. In der Zwischenzeit hatten sich die Ereignisse allerdings überstürzt. Eine große kaiserliche Allianz bildete sich gegen Böhmen, wurde jedoch durch einen beherzten böhmischen Präventivschlag gegen Kasimir von Polen, gesprengt, wordurch die größte Gefahr beseitigt war. Mit der Wahl Karls zum römisch-deutschen König, dem baldigen Tod des Vaters und damit der Thronbesteigung Böhmens, fand sich bislang keine Gelegenheit mehr zur Annäherung. Seither waren fast zwei Jahre vergangen. Die junge böhmische Prinzessin war zwischenzeitlich sechs Jahre alt und der habsburgische Prinz Rudolph bald neun. Das Heiratsprojekt mit einer offiziellen Verlobung voranzutreiben, war geeignete Gelegenheit um die momentane Haltung Albrechts zu eruieren. Seine Loyalität die zum alten Kaiser bestand, musste nicht zwangsläufig auch für den Sohn gelten, Karl war dsher in zuversichtlicher Hoffnung Albrecht zur Neutralität zu bewegen. Zu Brünn trafen sich am 26. Mai 1348 beide Familien, wo die Verlobung feierlich begangen wurde. Prinzessin Katharina wurde anschließend an den Hof nach Wien gebracht, um dort ihre weitere Erziehung zu erfahren und auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten.
Karl nutzte den Moment und belehnte als Reichsoberhaupt den Herzog mit dessen zahlreichen Reichslehen in Österreich und Südwestdeutschland. Albrecht ließ den Akt zu, was die Mutmaßung Karls nicht widerlegte, dass der Herzog primär den Frieden für seine Ländereien wahren wollte. Vielleicht spielte sein forgeschrittenes Alter ebenfalls eine Rolle, wurde er soch in diesem Jahr bereits 50. Möglicherweise war er es längst schon leid geworden, in einem latenten Kriegszustand zu leben. Die nicht abebbenden Aufstände in den Schweizer Stammlanden waren schon lästig genug, einen ernsthaften Konflikt mit Karl schien er aus dem Weg gehen zu wollen. Zu nah lag seine Residenz Wien an der Grenze Böhmens, zu bekannt waren die verheerenden Streifzüge von Karls Marodeuren.
Anfang Juni erreichte Karl die lange ersehnte Nachricht. König Eduard von England verzichtete auf die ihm angebotene Krone, womit ein großer Druck von ihm abfiel. Doch die Delegatiin des Königs überbrachte nicht allein die Botschaft der reinen Absage nach Prag, wo Karl mittlerweile wieder angekommen war, sie hatte weit gewichtigere Botschaft bei sich. In einem Begleitschreiben überbrachte wurde englisches Bündnisangebot unterbreitet, allgemeiner Natur wie auch gegen Frankreich im speziellen gerichtet. Karl musste und konnte diesen Teil nur ablehnen, bzw. nur für den Fall zusagen, dass der König von Frankreich seinerseits gegen Reichsgebiet vorging. Immerhin gestand Karl englischen Truppen die freie Durchreise zu, wie auch die Erlaubnis im Reich Truppen zu werben. Es dürfte Eduard von vornherein klar gewesen sein, dass Karl vor dem Hintergrund seiner engen Beziehungen zum französischen Hof, niemals einem offensiven Bündnis gegen König Philipp VI. oder dessen Sohn Johann zustimmen würde. Es reichte ihm völlig, das Karl sich, unter Akzeptanz der sonstigen Klauseln, aus dem Krieg um den Thron Frankreichs heraushalten würde, damit war England ausreichend geholfen. Für Karl war umgekehrt von immensem Wert, dass jhn der König von England als Reichsoberhaupt anerkannte und damit der Gegenseite eine Absage erteilte.
Befeuert von den überaus guten Nachrichten aus England und den Zuversicht weckenden Ereignissen anlässlich der Verlobungsfeier seiner zweiten Tochter Katherina, begann Karl mit einem weiteren Bauprojekt. Diesmal nicht im pulsierenden Prag, sondern etwa 30 Kilometer südwestlich davon, nach damaliger Reisegeschwindigkeit, rund vier Stunden von der Residenz entfernt. Karl wünschte eine bewusst abgelegene, den gestiegenen Anforderungen an Sicherheit und Repräsentationsbedürfnissen gerecht werdende Wohnburg zu errichten. Am 10. Juni 1348 legte Erzbischof Ernst von Prag den Grundstein zum Karlstein (tschech: Karlštejn). Die Festung wurde zur Schatzkammer des böhmische Königreichs, Karl ließ hier unter anderem auch später seine reichhaltige Reliquiensammlung deponieren.
Anfang Juli kamen die beiden Brüder Albrecht (1318 – 1379) und Johann von Mecklenburg (1326 – um 1393) aus dem Norden des Reichs nach Prag gereist um Karl zu huldigen und ihn als ihren König anzuerkennen. Sie waren die bislang nördlichsten Fürsten die sich unterwarfen und sie taten es mit kluger Berechnung, denn der König erhob beide in den Herzogstand. Karl ließ den Belehnungsakt feierlich am Prager Hofe feiern und zahlreiche Reichsfürsten waren zugegen.
Ludwig gibt nicht auf
Die Wittelsbacher Partei gab den Kampf um die Krone weiterhin noch nicht auf. Die abschlägige Nachricht aus England vermochte sie nur kurz zu schocken, schon wurde nach einem weiteren Kandidaten gesucht.
Zwischenzeitlich ging die große Reichsstadt Nürnberg zur Partei Ludwigs des Brandenburgers über und wandte sich gegen Karl. Die Bürgerschaft lehnte sich gegen den Magistrat, der Karl im Vorjahr huldigte, auf und trieb sie aus der Stadt. Die Nürnberger Burggrafen waren machtlos dagegen und mussten Sorge tragen, nicht selbst völlig bei den Bürgern in Ungnade zu fallen. Nürnberg rief Ludwig den Brandenburger zum König aus, der jedoch wusste, dass eine Krone aus den Händen und Mündern des städtischen Standes, keinerlei Wert, Ansehen oder je Anerkennung unter den Reichsfürsten erhielte. Statt also darauf einzugehen, einigte man sich auf einen neuen Kandidaten, den man in dem Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen, Friedrich II. „der Ernsthafte“ (1310 – 1349), aus dem Hause Wettin, einem Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers, glaubte gefunden zu haben. Friedrich nahm die Krone ebenfalls nicht an. Ähnlich wie Albrecht von Österreich, lag ihm mehr daran seine Länder von einem zu erwatenden Krieg unbeschädigt zu lassen. Die unmittelbare Nachbarschaft zu Böhmen und Sachsen-Wittenberg und die bisherige Schwäche der Wittelsbacher Partei, veranlassten ihn nach njr kurzer Bedenkzeit, zu diesem Entschluss. Im weiteren Verlauf des Jahres traf sich der Landgraf in Bautzen, in der Oberlausitz, mit Karl, erkannte ihn als den römisch-deutschen König an und nahm von ihm seine Ländereien zu Lehen. Ein großer weiterer Eckpfeiler in der stärker und stärker werdenen Bastion Karls und ein empfindlicher Verlust für die Gegenpartei. Doch es war zu früh sich in Sicherheit zu wiegen. Auch wenn immer mehr Fürsten und sehr viele der Reichsstädte sich bereits unterworfen hatten, so verfügte Karl bei kritischer Betrachtung, über keine wirklichen Verbündeten. Die allermeisten seiner Vasallen außerhalb Böhmens, waren reine Nutznießer seiner großzügigen Schenkungen und Zuwendungen königlicher Privilegien. Ob sie sich auch für ihn in einer Schlacht schlagen würden, dessen war sich Karl ganz und gar nicht sicher. Die Ereignisse in Nürnberg bewiesen im darüber hinaus, dass es auch wieder zu einem Abfall kommen kann und nicht nur bei den Städten, noch wahrscheinlicher bei den Fürsten selbst.
Ludwig stand längst vor der Frage, wie soll es weitergehen? Zu einer Entscheidungsschlacht wie bei früheren Thronstreitigkeiten war es bislang nicht gekommen. Seit zwei Jahren stand die Wittelsbacher Opposition gegen Karl, der in dieser Zeit deutlich an Boden gutmachte aber auch gleichzeitig mehrere Vermögen an Geld und Privilegien dafür aufwenden musste. Aber auch Ludwig gingen zunehmend die Gelder aus. Die Mark Brandenburg war kein übermäßig reiches Fürstentum, die Stände, besonders der märkische Adel traditionell sehr selbstbewusst und stark autonom, die Städte zumeist klein und unbedeutend, wenn auch der Handel einen gewissen Wohlstand für zahlreiche dieser Komunen brachte. Bayern war unter den fünf Söhnen des verblichenen Kaisers aufgeteilt und nicht alle der vier Brüder Ludwigs zogen immer an einem Strang mit ihm, wobei der jüngste noch ein Knabe war. Ludwig musste, nachdem es sich bereits abzuzeichnen schien, dass es in diesem Jahr zu keiner Entscheidung kommen wird, dringend sein Heer reduzieren um die immensen Kosten zu reduzieren. Er suchte daher den Verhandlungsweg und Karl, dessen Kassen leer waren und der eine Lust an den vielfältigen Bautätigkeiten der zurückliegenden Monate, wie überhaupt an einem ruhigen Regentenleben ohne permanente Reisen unter kriegsähnlichen Bedingungen, entwickelte, akzeptierte bereitwillig das Gesuch. Unter der Vermittlung von Herzog Albrecht II. von Österreich, traf man sich in der letzten Juliwoche des Jahres 1348 in Passau. Karl traf zuerst ein, es folgten verschiedene Vertreter seiner Anhängerschaft und endlich kam Ludwig, in Begleitung seiner Brüder und 2.000 schweren Reitern. Unzweifelhaft wollte er damit ein starkes Signal setzen und hoffte Eindruck zu machen. Die Partei Karls hatte gewisse Sorgen, er könnte aus einem konstruierten Grund heraus die Versammlung sprengen und versuchen sich des Königs zu bemächtigen. Ludwig hielt sich jedoch streng an das Prozedere, stellte aber der Überlieferung nach überzogene Forderungen auf, die einen Vergleich sehr erschwerten, gleichzeitig kam das Gerücht auf, er hätte sich mit Eduard von England verbündet, welcher der niederländischen Grafschaften Seeland und Holland den Wittelsbachern entreißen sollte. An diesem hartnäckigen Gerücht zerbrachen die Verhandlungen vollends. Ludwig und sein Gefolge verließen Passau. Vor der Abreise erklärte er öffentlich, dass er Karl niemals als römisch-deutschen König anerkennen wird.
Blanka von Valois stirbt
Nachdem die Friedensverhandlungen, zumindest hofften viele dass es solche werden würden, frühzeitig gescheitert waren, nutzte Karl die Gelegenheit die anwesenden Bischöfe von Passau und Salzburg mit ihren Reichsgütern zu belehnen. Damit schlossen sich zwei weitere Fürsten formell dem Lager des Königs, gleichwohl auch sie passive Beobachter des dahintröpfelnden Konflikts blieben.
Hierauf bestieg er gemeinsam mit Herzog Albrecht von Österreich ein Schiff auf der Donau und fuhr flussabwärts bis Linz, wo sich ihre Wege trennten. Karl erhielt die Nachricht, dass seine Gattin Blanka Margarete ernsthaft erkrankt sei. Er setzte nun seinen Weg ohne größere Aufenthalte nach Böhmen dort, kam jedoch zu spät. Seine Frau war am 1. August 1348 verstorben, sie hinterließ die beiden Töchter Margarete und Katharina, die beide schon in Kindertagen an die Höfe nach Visegrád in Ungarn und Wien, an den Habsburger Hof verlobt wurden. Für Karl war es ein großer Verlust. Obgleich auch seine Ehe schon im Kindesalter, aus politischen Erwägungen heraus, beschlossen und umgesetzt wurde, bestand zwischen beiden ein vertrauensvolles und liebevolles Eheband. Blanka fiel durch ihr Wirken nicht aus der Reihe, sie eignete sich die böhmische und deutsche Sprache an und war ihrem Mann in den zurückliegenden Jahren eine wichtige Stütze und geschätzte Beraterin. Das böhmische Volk, gemeint ist hier hauptsächlich die Prager Bürgerschaft, trauerte mit dem König um die verstorbene Landesherrin. Sie wurde mit königlichem Zeremoniell im Prager Dom beigesetzt.
Mit ihrem Tod trat ein ernstzunehmendes Defizit zu Tage. Dem Königreich fehlte noch immer ein männlicher Erbe. Ein von ihr geborener Knabe, dem man den Namen Johann gab, starb noch als Kleinkind. Für Karl war eine baldige Neuvermählung aus dynastischen Gründen unausweichlich, für lange Trauer blieb keine Zeit. Als Papst Clemens VI. vom Verlust des Königs hörte, schickte er ihm neben den offiziellen Beileidsbekundungen den Ratschlag, sich erneute eine französische Prinzessin zur Frau zu nehmen. Der Papst, selbst ein Franzose, war besorgt, die bisher so enge Beziehung des Hauses Luxemburg zur Krone Frankreichs könnte ganz abreißen. Karl sah aber von einer neuerlichen Heirat einer Tochter aus dem königsnahen Hochadel Frankreichs ab. Zur Wahrung seiner aktuellen Interessen, erschien eine andere Heirat zielführender.
Der falsche Waldemar
Dem später als Betrüger entlarvten, sogenannten falschen Waldemar, in vielen Geschichtswerken auch als Woldemar bezeichnet, haben wir bereits in Buch 2 mehrere Abschnitte gewidmet. Es ist ein Beweis, dass es sich hierbei, im Kontext der Ereignisse rund um den schwelenden Thronstreit, um eine ganz besonders ungewöhnliche Episode in der deutschen Reichsgeschichte handelte. In keinem vergleichbaren Fall, zuvor oder danach, vermochte sich ein Hochstabler in so großem Umfang zu etablieren.
Als im Jahre 1319 Markgraf Waldemar, aus dem Hause der Askanier, unerwartet starb, stand das Geschlecht jenes Fürstengeschlechts das die Mark 1157 gründete, in Brandenburg unmittelbar vor dem Aussterben. Mit dem Tod Heinrichs II. noch im Knabenalter, schon im Folgejahr, waren die Askanier in diesem Teil des Reichs erloschen und die Mark Brandenburg fiel nach Jahren des Zerfalls ans Reich zurück. 1323 belehnte der damalig König Ludwig IV., der spätere Kaiser, seinen ältesten Sohn Ludwig mit den Provinzen zwischen Elbe und Oder. Jener Ludwig, der jetzt zum großen Widersacher Karls IV. wurde.
Soviel zur Vorgeschichte. Im Sommer 1348 trat im Erzbistum Magdeburg, vor dem dortigen Erzbischof Otto I. von Hessen (1301 – 1361) ein Mann auf, der von sich behauptete, der totgeglaubte Markgraf Waldemar zu sein. Als Grund für sein angebliches Verschwinden gab der vor dem Kirchenfürsten stehende Mann an, er hätte eine lange Buß- und Pilgerreise ans Grab Christi gemacht. Grund für die vermeintliche Reise wäre das enges Verwandtschaftsverhältnis zwischen Waldemar und seiner Ehefrau gewesen. Tatsächlich war Agnes von Brandenburg seine Cousine und stammte aus der jüngeren sogenannten Ottonischen Linie der brandenburgischen Askanier. Ihr Vater war Markgraf Hermann, genannt „der Lange“, Sohn Ottos V. von Brandenburg. Damit die Ehe trotz der nahen Verwandtschaft begangen werden konnte, wurde ein päpstlicher Dispens erteilt, nachdem zuvor eine vom Heiligen Stuhl vorgegebene Geldsumme entrichtet wurde. Vergleichbare Ehe waren im europäischen Hochadel keine Seltenheit, die Genehmigung durch den Papst reichte in der Wahrnehmung der Zeitgenossen als absolut ausreichende Legitimation. Das von dem Unbekannten in Magedburg ins Feld geworfene Argument hätte unter normalen Umständen die anwesenden Zeugen nicht nur höchst skeptisch machen müssen, sie hätten es schlichtweg für abwegig gehalten, wären nicht politische Erwägungen dem entgegengestanden. Zur eindeutigen Klärung konnte die Ehefrau des Markgrafen Waldemar schon nicht mehr herangezogen werden, sie war bereits vor über 20 Jahren verstorben.
In beeindruckend rascher Folge, wurde der falsche Waldemar von den lokalen Reichsfürsten des sächsischen Raums anerkannt. Nicht nur beim Erzbischof von Magdeburg, auch an den askanischen Höfen von Anhalt, Sachsen-Wittenberg. Die letztgenannten Fürsten aus akanischen Seitenlinien, versprachen sich nach dem Tod des im Alter fortgeschrittenen Mannes, wer immer er auch wirklich sei, eine Anwartschaft auf die Mark. Hätte Markgraf Waldemar in der Person dieses Mannes überlebt, wäre die 1323 vollzogene Belehnungen an Ludwig den Brandenburger ungültig gewesen, womit die Mark weiterhin askanisch wäre. Als sich auch noch Karl IV. für den falschen Waldemar aussprach und ihn mit der Mark belehnte, brach in Brandenburg ein jahrelanger Konflikt zwischen dem Wittelsbacher Fürstenhaus und dem Prätendenten aus. Ganz wesentlich befeuert wurde die Auseinandersetzung durch den massenweisen Abfall märkischer Städte, den bislang treusten Angängern des Wittelsbacher in Brandenburg. Die Motivation dazu haben wir in Buch 2 beleuchtet und wollen es an dieser Stelle als gegebene Tatsache hinnehmen.
Für Karl IV. erwies sich das Erscheinen des Hochstablers als ganz unverhoffter Segen. Hierdurch war sein Rivale in den eigenen Kernlanden in einen schweren Machterhaltungskampf verwickelt, wodurch sich der eigentliche Streit um die Krone des Reichs, mehr und mehr zu seinen Gunsten verlagerte. Dass Karl die Situation wissentlich und willentlich ausnutzte, kann fast kaum bezweifelt werden. Im September und Oktober 1348 vollzog sich die offizielle Anerkennung und Belehnung Waldemars, der einige Tage zuvor die Lausitz an Böhmen abtrat. Den askanischen Fürsten von Sachsen und Anhalt wurde im Rahmen der Belehnung Waldemars die Anwartschaft auf die Mark offiziell bestätigt.
Jahre später, nach der angeblichen Überführung des Betrügers, wird Karl angeben, er wäre getäuscht worden. Hintergrund seines Sinneswandels war allerdings eine sich veränderte, politische Lage und die Tatsache, dass der falsche Waldemar nicht mehr für Karls weitere Zwecke benötigt wurde. Bis dahin sollten sich die Wittelsbacher ein weiteres Mal aufbäumen und einen weiteren Gegenkandidaten aufstellen.
Die Wahl eines Gegenkönigs
Für Ludwig zeichnete sich immer mehr ein endgültiger Misserfolg ab. Karl bekam im Reich ein zunehmendes Übergewicht. Auch wenn dessen Anhänger kaum Aktivitäten zu seinen Gunsten zeigten und sich darin gefielen mit dem Lehnseid genügend Loyalität gezeigt zu haben, ging der Partei um Ludwig der Zuspruch und die Mittel aus. Große Teile des nordostdeutschen Raums und damit die meisten an die Mark Brandenburg grenzenden Reichsterritorien, hatten zwischenzeitlich Karl gehuldigt, mit die letzten in diesem Raum waren die pommerschen Herzöge, Bogislaw V. (1318 – 1374), Barnim III. (vor 1300 – 1368) und Wartislaw V. (1326 – 1390), die am 14. Oktober zu Stettin Karl einen Treuebrief ausstellten. Schon am 4. Juni 1348 hatte Karl Pommern die Reichsinmittelbarkeit bestätigt, um damit die Herzöge zum Ablegen des Lehnseid zu bewegen. Seine Rechnung ging selbstverständlich auf, schon aus der generationenlangen Rivalität mit Brandenburg.
Derweil kam es in der Mark zur ersten militärischen Gegenreaktion des wittelsbachischen Markgrafen Ludwig. Dieser ging mit einem Heerauaufgebot gegen den falschen Waldemar vor, musste bald, noch bevor er Entscheidendes erreichte, vor einem überlegenen Heer Karls IV., der dem Schwindler zu Hilfe kam, ausweichen und flüchtete sich nach Frankfurt an der Oder. Die wichtige Hansestadt an der Oder blieb den Wittelsbachern als eine der wenigen märkischen Städte treu. Frankfurts Oderhandel litt seit geraumer Zeit unter protektionistischen Maßnahmen Karls entlang des schlesischen Oberlaufs der Oder, insbesondere in Breslau. Das Heer Karls, verstärkt von kleineren Kontingenten aus Pommern und Sachsen, begann die stark befestigte Stadt zu belagern, unternahm alledings keinen Erstürmungsversuch. Mit einsetzendem Herbstwetter musste die Belagerung erfolglos abgebrochen werden. Eine mit starken Mauern geschützte Stadt, noch dazu wenn sie von Truppen belegt war, konnte nur unter Inkaufnahme großer eigener Verluste ermöglicht werden. Für gewöhnlich zeigten sich die auf leichtes Plündern ausgerichteten Kriegsknechte wenig ambitioniert ihr Leben zunriskieren, es sei denn der Heermeister war bereit in die Goldschatulle zu greifen und entsprechende Handgelder zu verteilen. Als Alternative blieb fast nur noch eine langwierige Hungerbelagerungen, was die Kriegskasse auf Dauer nicht weniger, sondern für gewöhnlich noch mehr belastete. Lag die Stadt dann noch an einem Fluss oder gar an der See, blieb den Belagerten darüber hinaus zahlreiche Gelegenheiten Versorgungsgüter, selbst frische Truppen einzuschleusen, wodurch die Chance auf ein erfolgreiches Aushungern ganz erheblich sank. Für Karl, dem weder blutige Erstürmungen noch ruinös lange Belagerungen ins Naturell und zeitliche Konzept passte, blieb nur der Abbruch der Belagerung. Beide Seiten gingen jetzt zur Winterruhe über und entließen die angeworbenen Kriegsleute. Auf politischer Ebene wütete der Kampf dennoch unvermittelt weiter. Ludwig, weiterhin unter dem Bann des Papstes, setzte seine ganze Hoffnung auf einen langjährigen, thüringischen Parteigänger seines verstorbenen Vaters. Mit Graf Günther XXI. von Schwarzburg-Blankenburg (1304 – 1349) hoffte man endlich einen Kandidaten gefunden zu haben, der nach erfolgter Wahl die Krone des Reichs annehmen und militärisch durchsetzen würde. Nach wochenlangen Verhandlungen erklärte sich der Graf unter bestimmten Bedingungen bereit sich zu als Knadidat zur Königswahl aufstellen zu lassen. Zur Wahl zum Gegenkönig des ehemaligen Gegenkönigs. Günther stammte aus sehr altem thüringischen Adel und war als Diplomat im Dienst des vormaligen Kaisers Ludwig, als solcher prädestiniert die Interessen der Wittelsbacher Partei zu vertreten. Seine Stellung in Thüringen konnte er durch einige, überaus erfolgreich geführte lokale Fehden, fortlaufend festigen und ausbauen. Sein Vermögen war durch lukrative Lösegelder und zahlreiche Brandschatzungen gewachsen, was ihn in der Region, trotz der mächtigen Nachbaren in Sachsen-Wittenberg oder Meißen zu einer Instanz machte.
Wir haben davon gesprochen, dass Günther von Schwarzenberg für seine Zustimmung zur Kandidatur gewisse Bedingungen stellte. In der bisherigen Reichsgeschichte, stellte dies ein Ausnahme dar. Es war bislang einmalig, dass ein Kandidat regelrecht gebeten werden musste das höchste weltliche Amt anzustreben. Dafür auch noch auf dessen Forderungen einzugehen, zeigte die herausragende Besonderheit dieses Mal und gleichzeitig die Verzweiflung auf der Seite der Opposition. Zu den Bedingungen gehörte beispielsweise der Verzicht der Wahlfürsten, für ihre Stimme eine Bezahlung zu verlangen. Eigentlich war die Forderung nur angemessen und noch mehr selbstverständlich, doch zeigte sich schon seit vielen Generationen, dass Stimmenkauf eine mitunter wahlentscheidende Konstante im Vorfeld des eigentlichen Wahlakts war. Aufgrund der desperaten Lage war dahingehend schnell eine Einigung erzielt.
Am 30. Dezember 1348 legte der vom Papst abgesetzte aber in seiner Kirchenprovinz weiterhin anerkannte Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg, den Wahltag zu Frankfurt auf den 16. Januar 1349 fest. Tatsächlich fand die Wahlzusammenkunft dann erst zwei Wochen später, am 30. Januar statt. Mit den Stimmen des Erzbischofs von Mainz, des Pfalzgrafen zu Rhein, des Herzogs von Sachsen-Lauenburg und des Markgrafen von Brandenburg, es waren diese die anwesenden, oppositionellen Kurfürsten, wurde Günther von Schwarzburg zum römisch-deutschen König gewählt. Am 6. Februar 1349 zog er feierlich in Frankfurt ein. Vergessen war die Tatsache, dass die Stadt ihn eine Woche vor den verschlossenen Toren hatte warten lassen. In dieser Zeit lieferten sich die städtischen Anhänger Karls und jene des verstorbenen Kaisers Ludwig, aus dessen Reihen nun ein Kandidat zum König bestimmt wurde, hitzige Debatten, die schließlich von den alten Anhängern der Wittelsbacher gewonnen wurden. Rasch wurde der neue König, der Gegenkönig zu Karl IV., von den Städten Frankfurt, Friedberg und Gelnhausen anerkannt.
Karl hielt sich zu dieser Zeit am oberen Niederrhein bei Bonn auf, um auf die weitere Entwicklung aus nächster Nähe zu beobachten. Noch war Winter, mit militärischen Operationen des Gegenkönigs war nicht zu rechnen, weswegen Karl in den nordwestlichen Teil des Reichs weiterreiste. Unter anderem traf er dort Wilhelm von Jülich, seinen bewährten Diplomaten. Wilhelm kam gerade vom englischen Hof zurück, im Gepäck die Vollmacht Edwards III. von England über ein Eheprojekt zu verhandeln. Eduard wollte durch eine Verbindung seiner ältesten Tochter Isabella (1332 – 1379) mit dem verwitweten Karl zusätzliche Gewissheit schaffen, dass der mächtige böhmische König und sich im Thronstreit wahrscheinlich durchsetzende römisch-deutsche König, sowie Kaiser in spe, sich nicht doch an die Seite Frankreichs schlagen könnte, um so alle bisherigen englischen Erfolge zunichte zu machen. Für Karl war es längst an der Zeit eine erneut Vermälung ernsthaft ins Auge zunfassen und einen männlichen Erben zu zeugen. Es ist nicht gesichert ob die finalen Verhandlungen zum Ehevertrag unmittelbar zwischen beiden Königen verhandelt wurden oder ob Eduard sich vertreten ließ, fest steht nur, beide Seiten konnten sich nicht einig werden, woran es konkret scheiterte ist nicht überliefert.
Im Reich begannen beide Seiten mit ernsthaften Zurüstungen. Noch vor seiner Abreise nach Norden, ordnete Karl für den 22. Februar eine Heerschau seiner Anhänger zu Mainz-Kastel an. Sein Gegner, Graf von Schwarzburg, tat es ihm gleich und ließ am genau gleichen Ort ein Turnier veranstalten um den heranziehenden Hilfsvölkern Karls den Schneid abzukaufen. Es entspann sich ein kurioses Bild, während sich die Streiter der einen Seite halb provokant dem ritterlichen Kampfspiel widmeten, beobachteten die andere Seite das Treiben ohne dass es zu Kampfhandlungen der versammelten Streitkräfte kam. Vielleicht wäre es zum jetzigen Zeitpunkt für den Herausforderer Günther von Schwarzberg günstig gewesen, in einem mutigen Erstschlag die noch nicht vollends versammelten Verbände anzugreifen, doch scheint es so, dass beiden Kontrahenten nicht der Sinn nach einer Schlacht stand. Zumindest Karl hatte sxhon seinerzeit den Ruf, einen persönlich geführten Kampf, wo immer es ging, nur aus einer zahlenmäßigen Überlegenheit heraus zu suchen, bei ausgeglichenen Kontingenten aber, der Schlacht so lange auszuweichen, bis die Mehrheitsverhältnisse zu seinen Gunsten umgeschwungen waren. Für den Moment trennten sich die beiden Heere wieder voneinander, lösten sich sogar teilweise wieder auf, ganz besonders bei den Mitstreitern des gewählten aber noch ungekrönten Gegenkönigs.
Karl nutzte die Gelegenheit um sich ganz einem für ihn lukrativeren Heiratsplan zu widmen. Vieles deutet darauf hin, dass er an diesem bereits Projekte arbeitete, schon während ihm der englische König die eigene Tochter anbot, denn die Rassanz mit der man sich einigte war auffallend. Schon am 4. März 1349 heiratete Karl auf Burg Stahleck, Anna von der Pfalz (1329 – 1353). Um die besondere Relevanz dieser Vermälung zu verstehen, müssen wir ein wenig ausholen.
Anna war die einzige Tochter, überhaupt das einzige Kind von Pfalzgraf Rudolf II. (1306 – 1353) aus dem Hause Wittelsbach. Rudolf regierte gemeinsam mit seinem Bruder Rupprecht die Pfalzgrafschaft bei Rhein und übte gemeinsam mit ihm die Kurwürde aus. Ihr Onkel war Kaiser Ludwig IV. von Bayern. Es kam zu mehreren Erbteilungen die für einige Zeit den innerfamiliären Streit bei den Wittelsbachern, wie er schon zwischen dem Vater Rudolf I. und dem Onkel Ludwig IV. existierte. Der Kaiser vermochte in den letzten Jahren seiner Regentschaft, durch einen Vergleich, den Konsens beider wittelsbachischen Hauptlinien wieder herzustellen, demzufolge blieben beide Pfalzgrafen, Rudolf II. und Ruprecht I. nach dem Tod des Kaisers enge Anhänger ihres Cousins Ludwig den man den Brandenburger nannte.
Noch im Februar stimmte Rudolf in Frankfurt für den wittelsbachischen Gegenkönig Günther von Schwarzburg. Jetzt, nach der Vermählung seiner Tochter, schied er aus dem Kreis der Oppositionellen aus und verhielt sich neutral. Dieser Umstand alleine, war für Karl nicht ausschlaggebender Faktor zur Hochzeit, vielmehr war es die Mitgift in Höhe von 8.000 Mark Silber und als Pfand für die Summe eine Anzahl Städte in der an Böhmen angrenzenden Oberpfalz. Weiter die Anwartschaft auf die Oberpfalz falls Rudolf II. ohne männlichen Erben verginge. Wir sehen hier wieder den rührigen Hochzeitspolitiker Karl, der jetzt erstmals eine Hochzeit nicht nur zur politischen Rückversicherung sondern zur territorialen Erweiterung heranzog.
Für die Opposition war die Hochzeit ein schwerer Schlag, denn mit Rudolf II. brach ein wichtiger Eckpfeiler nicht nur allein aus dem Lager des Gegenkönigs sondern unmittelbar aus der Familie der Wittelsbacher. Es drohte eine regelrechte Spaltung des pfälzischen Hauses. Karl sah sich jetzt in der rechten Verfassung um zum entscheidenden Schlag auszuholen. Zu Speyer berief Karl März/April 1349 einen Hoftag ein, dem auch einige Fürsten aus dem gegnerischen Lager beiwohnten. Die meisten davon sagten sich im weiteren Verlauf der Versammlung vom Gegenkönig los und huldigten Karl IV. nachträglich. Auf dem Hoftag wurde beschlossen erneut ein Heer aufzustellen das sich am 30. April zwischen Worms und Speyer, bei Frankenthal versammeln sollte. Am 5. Mai stieß Karl zu den versammelten Truppen hinzu und zog mit ihnen Rheinabwärts, dem bei Mainz stehenden Gegner entgegen. Zwischen dem 11. und 14. Mai kam es westwärts von Mainz, am Rhein zu einem kurzen Gefecht. Karl setzte in der Nähe von Eltville zum Rheinübergang an. Als Gegenmaßnahme kommandierte Günther von Schwarzburg eine Abordnung von 200 Panzerreitern und Rittern ab, den Übergang zu vehindern. Schon im ersten Angriff gelang es Karls Heerführer, dem Grafen Eberhard II. von Württemberg (1315 – 1392) die Verteidigung zu durchbrechen und in die Flucht zu schlagen. Im Angesicht dieser Szene ergriff den größten Teil des Heeres Panik und sie zerstreuten sich in die umliegenden Berge und Wälder. Günther von Schwarzburg, in Begleitung einiger hundert verbliebener Mitstreiter, setzte sich in das nahegelegene Eltville ab und verschanzte sich dort. Karl begann unverzüglich die Stadt zu belagern. Nur noch ein Wunder konnte die hoffnungslose Lage wenden, dies begriff Ludwig recht bald. Er war in wilder Eile aus München, nur in Begleitung weniger Ritter in die belagerte Stadt hinzugestoßen. Ebenso in der Stadt gefangen, waren Pfalzgraf Ruprecht und Erzbischof Heinrich von Virneburg, mit ihren engsten Vasallen und Mitstreitern. Es blieb nichts anderes mehr übrig, Ludwig ritt als Unterhändler in das Lager König Karls, wo er in allen Ehren empfangen wurde. Er ersuchte um Frieden und war bereit Karl als König anzuerkennen und gleichzeitig den Gegenkönig zum Kronverzicht zu bewegen. Als letztes erklärte er sich bereit die Reichskleinodien an Karl auszuhändigen, sobald er vom Kirchenbann befreit wäre, wozu Karl ihn unterstützen sollte. Karls erst kürzlich angetraute Gattin, wie auch ihr Vater, Pfalzgraf Rudolf, unterstützten das Gesuch des bayrischen Vetters, wodurch Karl ohne weitere Bedingungen zustimmte, sofern Graf Günther vom Amt des römisch-deutschen Königs zurücktrat.
Am 26. Mai 1349 wurden im Vertrag von Eltville die Klauseln des Friedensvertrags gegenseitig ratifiziert. Günther von Schwarzburg verzichtete auf alle Kronansprüche, entband alle Städte die ihm zuvor gehuldigt hatten von ihrem Eid und unterwarf sich Karl. Er erhielt umgekehrt 20.000 Mark in Silber als Entschädigung. Zur Deckung der Summe wurden ihm diverse Rheinzölle und städtische Steuern verschrieben. Weiter übernahm Karl die Schulden des Grafen, die dieser bei der Stadt Frankfurt in Höhe von rund 1.200 Mark Silber hatte. Abschließend sprach Karl in einem Gnadenbrief eine Generalamnestie für alle ehemaligen Anhänger des Gegenkönigs aus. Mit dem Vertrag von Eltville wurde der dreijähriger Thronstreit im Heiligen Römischen Reich beigelegt, auch wenn der Friede mit dem bayrischen Hause der Wittelsbacher erst im Folgejahr offiziell in Kraft trat. Karl war jetzt das unangefochtene Oberhaupt des Reichs, die Hoffnung auf zurückkehrende Stabilität war groß und der Friedensschluss höchste Zeit, denn schon stand ein neuer Schrecken vor der Tür, ja hatte sich längst entlang der Handelswege im nördlichen Reichsteil begonnen auszubreiten. Die große Pestwelle, der Schwarze Tod, war aus Italien kommend über die Schweiz ins Reich eingesickert. Diesem Themenblock wurde in Buch 2 ein ganzes Kapitel gewidmet, weshalb wir in den folgenden Kapiteln nur vergleichsweise rudimentär darauf eingehen werden.
Karls größter Widersacher Ludwig V., Markgraf von Brandenburg, Herzog von Oberbayern und Graf von Tirol, hatte tatsächlich den Widerstand aufgegeben, es war keine Finte von ihm. Die Verwicklungen in Brandenburg mit dem falschen Waldemar, der jahrelange, stetig erfolgloser werdende Widerstand gegen Karl, aufkommende innere Streitigkeiten unter den sechs Söhnen des verstorbenen Kaisers, sowie die Pest hinterließen Spuren bei ihm und zerten die Kräfte unnötig auf. Am Ende musste er den von ihm selbst aufgebauten Gegenkönig persönlich zum Thronverzicht bewegen. Immerhin blieb Tirol beim Hause Wittelsbach und Ludwig nutzte in den kommenden Jahren des Friedens die Zeit, um in Oberbayern und Tirol umfangreiche Verwaltungsreformen einzuführen.
Der resignierte König, Graf Günther von Schwarzburg, konnte den Friedensschluss und die Entschädigungszahlung nicht mehr genießen, er starb kaum drei Wochen später in Frankfurt, möglicherweise an den Folgen der Pest. Tatsächlich erreichte die Seuche die Stadt im Jahre 1349, den Stadtannalen entnehmen wir, dass in den 72 Tagen da die Pest in der Stadt grassierte, mehr als 2.000 Bürger den Tod fanden. Einer anderen Theorie folgend, starb er an den Spätfolgen einer Vergiftung, die ihm möglicherweise Anfang Mai 1349 widerfahren war. Der Graf selbst ging von einer Vergiftung aus und verfluchte noch auf dem Sterbebett seine untreuen Gefährten, die er im Verdacht hatte. Einzelne Chronisten berichten davon, dass ein gewisser Medicus mit Namen Freydank dem Grafen im Heerlager bei Frankfurt eine Arznei mischte, weil er sich kränklich fühlte. Nach der Sitte, musste er Arzt vor den Augen aller zuvor selbst davon einnehmen, erst danach nahm Günther den Rest zu sich. Drei Tage später starb der Arzt auf bislang ungeklärte Weise und auch Graf Günther litt unter schweren Leibeskrämpfen. Ein Gehilfe des Mediziners wurde verdächtig die Arzneimischung vergiftet zu haben. Bis zu seinem schließlichen Dahinscheiden, schien er nicht mehr richtig gesund geworden zu sein und musste unter großen Beschwerden gegen Karl ins Feld ziehen. Nach dem Friedensschluss von Eltville wurde der bereits schwer Leidende auf einer Bahre nach Frankfurt geschafft. Er selbst war nicht mehr in der Lage auf einem Pferd zu reiten. Gegen die Annahme er wäre an der Pest gestorben, spricht der lange, mehrwöchige Krankheitsverlauf, welcher völlig untypisch wäre. Karl ließ unter großem Zeremoniell den Leichnam des Verstorbenen im Frankfurter Dom beisetzen. 20 Reichsgrafen trugen den Toten zur letzten Ruhe. Karl wohnte dem Leichenbegängnis persönlich bei. Gerade dies spricht gegen die Theorie er wäre an der Pest gestorben.
Mit der Beisetzung Günthers von Schwarzburg wurde symbolisch auch der deutsche Thronstreit zu Grabe getragen. Was wird der jetzt unangefochtene Monarch dem Reich an Segnungen oder möglicherweise sogar Flüchen bringen?

 In Oberitalien war er für fast zwei Jahre als Statthalter eingesetzt, es war ursprünglich als eine einfache Aufgabe angedacht, doch sah er sich fast augenblicklich, kaum hatte Johann Italien verlassen, einer rasch ausbreitenden Rebellion gegenüber, deren er dauerhaft nicht Herr wurde. Der Vater hatte die Umstände und besondere Dynamik in der lombardischen Region unterschätzt und den Sohn vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung gestellt. Die italienische Episode ging für das Haus Luxemburg im Spätsommer 1333 mit einem fast völligen Rückzug weitestgehend zu Ende. Johann von Böhmen musste notgedrungen seine Ambitionen in Italien aufgeben. Der Preis für eine Erweiterung der eigene Hausmacht im italienischen Raum, konnte auf Dauer nicht geleistet werden. Selbst wenn er im Verein mit dem Sohn, unter Anspannung aller Kräfte, die Lage vor Ort für den Moment hätte retten können, das Risiko mit dem Kaiser wegen seiner Aktivitäten in Reichsitalien in ernsthafte Verwicklungen zu geraten, war unter den gänzlich veränderten Bedingungen nicht mehr vertretbar. Schon standen die Habsburger in Wartestellung, um eine böhmische Schwäche auszunutzen. Sie wären in dieser Angelegenheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an die Seite des Kaisers gesprungen. Im gemeinsamen Konzert wäre die gesamte böhmisch-luxemburgische Stellung in Gefahr geraten. Es wäre eine hervorragende Gelegenheit gewesen alte und verlorengegangene habsburgische Ansprüche auf Mähren, vielleicht sogar auf ganz Böhmen zu erneuern. Nach der Niederlage von Mühlberg, musste Habsburg seinerzeit alle Ansprüche aufgeben, um dadurch den in Böhmen gefangen gesetzten Herzog Heinrich von Österreich auslösen zu können. König Johann forderte dies als Preis für die Freilassung des Bruders. Für den sehr wahrscheinlichen Fall einer kaiserlichen Intervention, hätten es die Habsburger bei einer Erneuerung ehemaliger Ansprüche freilich nicht übertreiben dürfen. Eine Ausweitung, über Mähren hinaus auf ganz Böhmen, wäre am Widerstand des Kaisers und weiterer Reichsfürsten gescheitert, doch die kleine mährische Lösung wäre wahrsxheinlich eine vom Reichsoberhaupt akzeptierte Option gewesen. Johann war klug genug sich nicht in Italien zu verausgaben, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen und die bisherigen Anstrengungen abzuschreiben, um damit weitaus Schlimmeres zu verhüten. Dass sein italienisches Abenteuer trotzdem nicht ganz spurlos am Verhältnis zum Kaiser vorüber ging, konnte man daran erkennen, dass ihn sein erster Weg zurück in den nördlichen Reichsteil, an den Hof Ludwigs IV. nach München führte, um sich mit ihm wegen Oberitalien zu vergleichen. Der Kaiser schien es ihm nicht sonderlich schwer maxhen zu wollen, immerhin hatte er Johanns tatkräftige Hilfe bei Mühlberg nicht vergessen. Es reichte Lidwig für den Moment völlig, dass Johanns Mission in der Lombardei ergebnislos blieb und er gleichzeitig dabei Federn ließ, was seinen weiteren Ambitionen in Reichsangelegenheiten für den Augenblick einen Riegel vorschob und umgekehrt dem Kaiser Raum für eigene Pläne ließ. Pläne die möglicherweise schon damals am reifen waren. Hinsichtlich des beiderseitigen Verhältnisses blieb aber immerhin doch ein Makel, eine unschöne Schramme zurück.
In Oberitalien war er für fast zwei Jahre als Statthalter eingesetzt, es war ursprünglich als eine einfache Aufgabe angedacht, doch sah er sich fast augenblicklich, kaum hatte Johann Italien verlassen, einer rasch ausbreitenden Rebellion gegenüber, deren er dauerhaft nicht Herr wurde. Der Vater hatte die Umstände und besondere Dynamik in der lombardischen Region unterschätzt und den Sohn vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung gestellt. Die italienische Episode ging für das Haus Luxemburg im Spätsommer 1333 mit einem fast völligen Rückzug weitestgehend zu Ende. Johann von Böhmen musste notgedrungen seine Ambitionen in Italien aufgeben. Der Preis für eine Erweiterung der eigene Hausmacht im italienischen Raum, konnte auf Dauer nicht geleistet werden. Selbst wenn er im Verein mit dem Sohn, unter Anspannung aller Kräfte, die Lage vor Ort für den Moment hätte retten können, das Risiko mit dem Kaiser wegen seiner Aktivitäten in Reichsitalien in ernsthafte Verwicklungen zu geraten, war unter den gänzlich veränderten Bedingungen nicht mehr vertretbar. Schon standen die Habsburger in Wartestellung, um eine böhmische Schwäche auszunutzen. Sie wären in dieser Angelegenheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an die Seite des Kaisers gesprungen. Im gemeinsamen Konzert wäre die gesamte böhmisch-luxemburgische Stellung in Gefahr geraten. Es wäre eine hervorragende Gelegenheit gewesen alte und verlorengegangene habsburgische Ansprüche auf Mähren, vielleicht sogar auf ganz Böhmen zu erneuern. Nach der Niederlage von Mühlberg, musste Habsburg seinerzeit alle Ansprüche aufgeben, um dadurch den in Böhmen gefangen gesetzten Herzog Heinrich von Österreich auslösen zu können. König Johann forderte dies als Preis für die Freilassung des Bruders. Für den sehr wahrscheinlichen Fall einer kaiserlichen Intervention, hätten es die Habsburger bei einer Erneuerung ehemaliger Ansprüche freilich nicht übertreiben dürfen. Eine Ausweitung, über Mähren hinaus auf ganz Böhmen, wäre am Widerstand des Kaisers und weiterer Reichsfürsten gescheitert, doch die kleine mährische Lösung wäre wahrsxheinlich eine vom Reichsoberhaupt akzeptierte Option gewesen. Johann war klug genug sich nicht in Italien zu verausgaben, rechtzeitig einen Schlussstrich zu ziehen und die bisherigen Anstrengungen abzuschreiben, um damit weitaus Schlimmeres zu verhüten. Dass sein italienisches Abenteuer trotzdem nicht ganz spurlos am Verhältnis zum Kaiser vorüber ging, konnte man daran erkennen, dass ihn sein erster Weg zurück in den nördlichen Reichsteil, an den Hof Ludwigs IV. nach München führte, um sich mit ihm wegen Oberitalien zu vergleichen. Der Kaiser schien es ihm nicht sonderlich schwer maxhen zu wollen, immerhin hatte er Johanns tatkräftige Hilfe bei Mühlberg nicht vergessen. Es reichte Lidwig für den Moment völlig, dass Johanns Mission in der Lombardei ergebnislos blieb und er gleichzeitig dabei Federn ließ, was seinen weiteren Ambitionen in Reichsangelegenheiten für den Augenblick einen Riegel vorschob und umgekehrt dem Kaiser Raum für eigene Pläne ließ. Pläne die möglicherweise schon damals am reifen waren. Hinsichtlich des beiderseitigen Verhältnisses blieb aber immerhin doch ein Makel, eine unschöne Schramme zurück.


 Karl wurde am 14. Mai 1316 in Prag geboren. Sein Vater war der ebenso illustre wie streitbare König Johann von Böhmen, der später, in Folge einer tragischen Augenerkrankung, den Beinamen „der Blinde“ erhält. Johann entstammte dem Geschlecht der Luxemburger, einer noch vor zwei Generationen unbedeutenden Grafendynastie aus dem Westen des Reichs. Johanns Vater, der vormalige römisch-deutsche König Heinrich VII., vermochte nach vielen Generationen erstmals neben der Königs- auch wieder die Kaiserkrone zu erlangen. Johanns Vater arrangierte 1311 die Heirat mit Elisabeth von Böhmen. Seine Gattin, eine Nachfahrin der Přemysliden, ging aus dem alten, im Mannesstamme erloschenen böhmischen Königsgeschlecht hervor. Über ihre Mutter war sie zugleich mit dem Hause Habsburg verwandt. Ihr Großvater aus der mütterlichen Linie war der ehemalige römisch-deutsche König Rudolf I. von Habsburg. Sie war Tochter König Wenzels II., mit dessen Tod die Dynastie der Přemysliden, wie schon erwähnt, männlicherseits ausstarb. Durch Heirat einer Blutsverwandten des alten Königshauses, qualifizierte sich Johann bei den böhmischen Ständen als Thronkandidat, worauf sie ihn wählten. Böhmen gehörte einst zu den reichsten, bevölkerungsstärksten und größten Territorien des Heiligen Römischen Reichs. Das Land genoss eine Reihe spezieller Privilegien, nicht zuletzt eine eigene Königskrone tragen zu dürfen. Ein zweiter König, neben dem Reichsoberhaupt, war bis dahin ein Novum im Alten Reich. Dieses Sonderprivileg ging noch auf Friedrich II. zurück. Er bestätigte im Jahre 1212 dem damaligen böhmischen König Ottokar I. Přemysl dessen Königtum und erklärte ihn zum vornehmsten Fürsten des Reichs. Dies geschah in Anerkennung der geleisteten Unterstützung Ottokars anlässlich der Wahl Friedrichs zum römisch-deutschen König.
Karl wurde am 14. Mai 1316 in Prag geboren. Sein Vater war der ebenso illustre wie streitbare König Johann von Böhmen, der später, in Folge einer tragischen Augenerkrankung, den Beinamen „der Blinde“ erhält. Johann entstammte dem Geschlecht der Luxemburger, einer noch vor zwei Generationen unbedeutenden Grafendynastie aus dem Westen des Reichs. Johanns Vater, der vormalige römisch-deutsche König Heinrich VII., vermochte nach vielen Generationen erstmals neben der Königs- auch wieder die Kaiserkrone zu erlangen. Johanns Vater arrangierte 1311 die Heirat mit Elisabeth von Böhmen. Seine Gattin, eine Nachfahrin der Přemysliden, ging aus dem alten, im Mannesstamme erloschenen böhmischen Königsgeschlecht hervor. Über ihre Mutter war sie zugleich mit dem Hause Habsburg verwandt. Ihr Großvater aus der mütterlichen Linie war der ehemalige römisch-deutsche König Rudolf I. von Habsburg. Sie war Tochter König Wenzels II., mit dessen Tod die Dynastie der Přemysliden, wie schon erwähnt, männlicherseits ausstarb. Durch Heirat einer Blutsverwandten des alten Königshauses, qualifizierte sich Johann bei den böhmischen Ständen als Thronkandidat, worauf sie ihn wählten. Böhmen gehörte einst zu den reichsten, bevölkerungsstärksten und größten Territorien des Heiligen Römischen Reichs. Das Land genoss eine Reihe spezieller Privilegien, nicht zuletzt eine eigene Königskrone tragen zu dürfen. Ein zweiter König, neben dem Reichsoberhaupt, war bis dahin ein Novum im Alten Reich. Dieses Sonderprivileg ging noch auf Friedrich II. zurück. Er bestätigte im Jahre 1212 dem damaligen böhmischen König Ottokar I. Přemysl dessen Königtum und erklärte ihn zum vornehmsten Fürsten des Reichs. Dies geschah in Anerkennung der geleisteten Unterstützung Ottokars anlässlich der Wahl Friedrichs zum römisch-deutschen König.



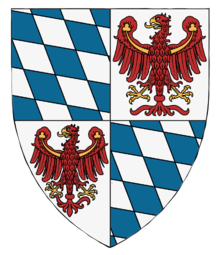




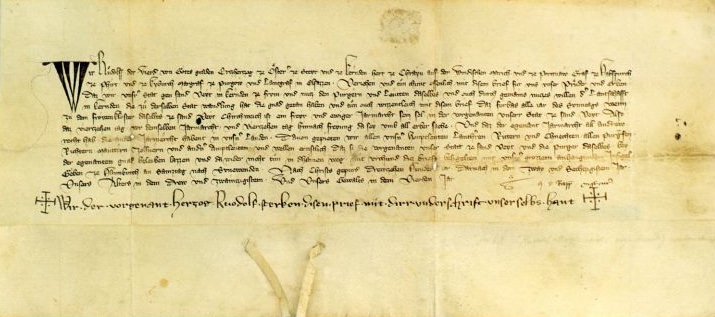
 Noch war die Kaiserkrone mit der Königswahl nicht automatisch verknüpft. In zahlreichen Italienzügen waren römisch-deutsche Könige bislang über die Alpen in die Ewige Stadt gezogen, um durch Diplomatie, oft jedoch unter Androhung oder Anwendung von Gewalt, die höchste weltliche Krone der Christenheit zu erlangen. Manchem gelang es überhaupt nicht. Gut ein halbes Jahrtausend sollte vergehen, bis die Wahl des Königs gleichsam die Wahl des Kaisers bedeutete.
Noch war die Kaiserkrone mit der Königswahl nicht automatisch verknüpft. In zahlreichen Italienzügen waren römisch-deutsche Könige bislang über die Alpen in die Ewige Stadt gezogen, um durch Diplomatie, oft jedoch unter Androhung oder Anwendung von Gewalt, die höchste weltliche Krone der Christenheit zu erlangen. Manchem gelang es überhaupt nicht. Gut ein halbes Jahrtausend sollte vergehen, bis die Wahl des Königs gleichsam die Wahl des Kaisers bedeutete.

 Die 23 Kapitel des Nürnberger Teils in voller Länge hier auszubreiten, würde den gegebenen Rahmen sprengen und die Geduld der Leserschaft auf eine zu harte Probe stellen. Um einen Hinweis auf den Umfang zu geben sei nur erwähnt, dass schon alleine das erste Kapitel nicht 26 Paragraphen beinhaltet.
Die 23 Kapitel des Nürnberger Teils in voller Länge hier auszubreiten, würde den gegebenen Rahmen sprengen und die Geduld der Leserschaft auf eine zu harte Probe stellen. Um einen Hinweis auf den Umfang zu geben sei nur erwähnt, dass schon alleine das erste Kapitel nicht 26 Paragraphen beinhaltet.

 Dem Bericht des Giovanni Boccaccio (1313 – 1375), der in seinem Meisterwerk „Das Dekameron“ (
Dem Bericht des Giovanni Boccaccio (1313 – 1375), der in seinem Meisterwerk „Das Dekameron“ ( den Gestank ihrer verwesenden Leichname, dass die tot waren … Sie selbst, oder mit Hilfe von Trägern, zogen die Leichen aus den Häusern und legten sie vor die Tür, wo man Morgens zahllose mengen davon sehen konnte. Man ließ Tragbahren kommen, und wo es keine gab, legte man die Toten auf ein Brett …“
den Gestank ihrer verwesenden Leichname, dass die tot waren … Sie selbst, oder mit Hilfe von Trägern, zogen die Leichen aus den Häusern und legten sie vor die Tür, wo man Morgens zahllose mengen davon sehen konnte. Man ließ Tragbahren kommen, und wo es keine gab, legte man die Toten auf ein Brett …“
 Man täte der mittelalterlichen Gesellschaft in Europa Unrecht, würde man unterstellen dass Mitleid, Hilfe oder ein enger Bezug zu Familienmitgliedern und Freunden nur rudimentär oder oberflächlich ausgebildet gewesen wäre. Unzählige Fürbittgottesdienste, Fürbitten allgemein sowie andere Dinge mehr, bezeugen eine enge soziale und moralische Bindung untereinander, die üblicherweise weit über den Tod der Angehörigen hinaus ging. Der Schrecken den der Schwarze Tod verbreitete, erschütterte die Menschen der Zeit so umfassend, dass viele der althergebrachten Konventionen und selbst engste soziale Bindungen einbrachen und gelegentlich völlig auflösten.
Man täte der mittelalterlichen Gesellschaft in Europa Unrecht, würde man unterstellen dass Mitleid, Hilfe oder ein enger Bezug zu Familienmitgliedern und Freunden nur rudimentär oder oberflächlich ausgebildet gewesen wäre. Unzählige Fürbittgottesdienste, Fürbitten allgemein sowie andere Dinge mehr, bezeugen eine enge soziale und moralische Bindung untereinander, die üblicherweise weit über den Tod der Angehörigen hinaus ging. Der Schrecken den der Schwarze Tod verbreitete, erschütterte die Menschen der Zeit so umfassend, dass viele der althergebrachten Konventionen und selbst engste soziale Bindungen einbrachen und gelegentlich völlig auflösten.


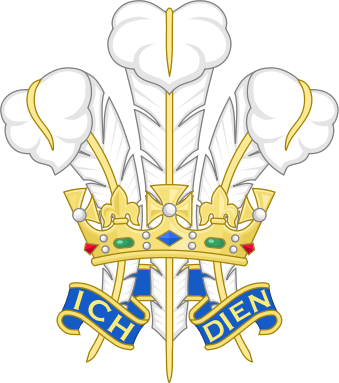

 Herzogin Margarethe von Tirol, über ihren verstorbenen Sohn, neuerliche Erbin Tirols, sah in dem Vorgehen des bayrischen Schwagers hinsichtlich Oberbayerns in sich ein schimpfliche Tat, wenngleich sie auf dieses Herzogtum keine Ansprüche geltend machen konnte. Sie hatte nicht vergessen, wie der Schwager ihren Sohn zu dessen Lebzeiten massiv beeinflusste und das Herzogtum abspenstig zu machen suchte, was zur Flucht des Sohnes aus dem eigenen Herzogtum führte. Einen zusätzlichen Übergriff auf Tirol, wie er sich schon abzeichnete, nahm sie selbstbewusste Regentin der Grafschaft nicht tatenlos hin. Hier zeigte sie eine ähnliche Verbissenheit wie man bei ihrer Schwiegermutter in der niederländischen Fehde erkennen konnte. Ihre Mittel waren allerdings sehr begrenzt. Auf eine starke Position in Tirol konnte sie sich nicht stützen. Schon zu Zeiten als ihr Mann noch lebte und ganz akut in der kurzen Zeit der Regentschaft ihres Sohnes Meinhard, gab es schwere kriegerische Verwerfungen mit dem Tiroler Adel. Herzog Stephan, unterstützt von seinem Halbbruder Albrecht von Bayern-Straubing und einem Mailänder Söldnerkontingent, rückte in Tirol ein. In dieser unhaltbaren Lage, überschrieb sie die Grafschaft an den ältesten Bruder ihrer Schwiegertochter, jener Margarethe von Habsburg, die wir oben kurz anschnitten. Unter Rudolf IV. wurde Tirol für die nächsten rund 550 Jahre habsburgisch. Sie musste jedoch erst aus den Händen Herzog Stephans entrissen werden.
Herzogin Margarethe von Tirol, über ihren verstorbenen Sohn, neuerliche Erbin Tirols, sah in dem Vorgehen des bayrischen Schwagers hinsichtlich Oberbayerns in sich ein schimpfliche Tat, wenngleich sie auf dieses Herzogtum keine Ansprüche geltend machen konnte. Sie hatte nicht vergessen, wie der Schwager ihren Sohn zu dessen Lebzeiten massiv beeinflusste und das Herzogtum abspenstig zu machen suchte, was zur Flucht des Sohnes aus dem eigenen Herzogtum führte. Einen zusätzlichen Übergriff auf Tirol, wie er sich schon abzeichnete, nahm sie selbstbewusste Regentin der Grafschaft nicht tatenlos hin. Hier zeigte sie eine ähnliche Verbissenheit wie man bei ihrer Schwiegermutter in der niederländischen Fehde erkennen konnte. Ihre Mittel waren allerdings sehr begrenzt. Auf eine starke Position in Tirol konnte sie sich nicht stützen. Schon zu Zeiten als ihr Mann noch lebte und ganz akut in der kurzen Zeit der Regentschaft ihres Sohnes Meinhard, gab es schwere kriegerische Verwerfungen mit dem Tiroler Adel. Herzog Stephan, unterstützt von seinem Halbbruder Albrecht von Bayern-Straubing und einem Mailänder Söldnerkontingent, rückte in Tirol ein. In dieser unhaltbaren Lage, überschrieb sie die Grafschaft an den ältesten Bruder ihrer Schwiegertochter, jener Margarethe von Habsburg, die wir oben kurz anschnitten. Unter Rudolf IV. wurde Tirol für die nächsten rund 550 Jahre habsburgisch. Sie musste jedoch erst aus den Händen Herzog Stephans entrissen werden.